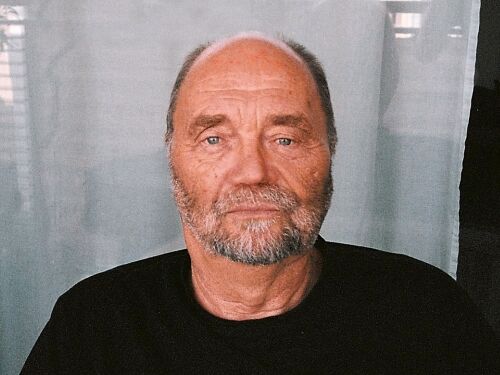Wo liegt die Mitte Europas?
Beiträge zur Leipziger Buchmesse 2023

Was meinen wir mit Europa? Was verstehen wir unter Mitteleuropa? Wie wird diese Mitte überhaupt definiert? Nachfolgend können Sie zu diesen Fragen Statements von Durs Grünbein, Kerstin Preiwuß, Jurko Prochasko und Cécile Wajsbrot lesen, die anlässlich einer Diskussion zu diesem Thema im Rahmen der Leipziger Buchmesse 2023 am 29. April 2023 im Literaturhaus Leipzig vorgetragen wurden. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie hier.
Durs Grünbein: Die neue Mitte Europas
Mit der Idee von einer geographischen Mitte ist es so eine Sache. Zum ersten Mal begegnete sie mir in einem phantastischen Roman, den ich als Kind las und der mir damals schon recht unwahrscheinlich erschien und mich doch fesselte, Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde. Merkwürdig wie vieles an diesem Bericht war schon die Route: daß man in einem Geysir auf Island in die Erde einfach so einsteigen konnte und in Italien durch einen Vulkankrater auf der Insel Stromboli wieder herauskam. Ähnlich irreal und nicht ganz ernst zu nehmen kamen mir später auch die Berichte von einem angeblichen Mittelpunkt Europas vor, wie sie immer mal wieder, aber wohl eher als Kuriosum durch die Presse geisterten. Mal wurde dieser im Nordosten Polens vermutet, dann fand man ihn in einem Dorf in Transkarpatien, auf ukrainischer Seite; auch in Tschechien, Bayern oder Belarus wurde er schon verortet. Einmal wurde er gar, und das ließ mich aufhorchen, in der Dresdner Altstadt markiert, an einem Platz unweit der Frauenkirche. Mittlerweile liegt er nun offiziell wieder viel tiefer im Osten, in einem Dorf in Litauen, etwas nördlich von Vilnius, anderen Berechnungen zufolge auch in Estland.
Dieses Wandern des Mittelpunktes erklärt sich natürlich durch die dauernden Grenzverschiebungen in der Geschichte des Kontinents, als Folge der Ausdehnung und des Zerfalls ganzer Reiche, etwa der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, des Dritten Reiches und der Sowjetunion. In seinem Oszillieren schwang aber auch immer die Frage mit, welches Territorium der Name des Kontinents denn eigentlich umschließt, wie seine Abgrenzungen definiert sein sollten. Und hier zeigten sich schnell die politischen Implikationen, bedenkt man den Umstand, daß die Europäische Union (ein bloßer Staatenbund, eine Wirtschaftssphäre mit eigener Sicherheitsgarantie) nie sich mit der im Atlas markierten Fläche deckte. Nach dieser geographischen Einteilung muß man zugeben: »Die Wolga entspringt in Europa«, um einen Buchtitel aus dem Jahre 1943 zu zitieren, Curzio Malapartes Bericht vom Rußlandfeldzug der Deutschen Wehrmacht.
Hitlers Eroberungspläne, die zum Glück für uns alle gescheitert sind, sahen nicht nur die Neubesiedelung des »Ostraums« bis weit über den Ural hinaus vor, sondern auch ein »Paneuropa« unter nationalsozialistischer Führung.
Wenn nicht alles täuscht, ist gerade wieder einmal ein solcher historischer Moment. Abermals ist die Mitte dabei, sich zu verschieben, aber auch unscharf zu werden. Im Augenblick scheint die neue imaginäre Mitte Europas sich nach Kyjiw verlagert zu haben. In der Ukraine wird zur Zeit mehr Blut für die Ideale Europas vergossen als an irgendeiner anderen Stelle des Kontinents. Erst im Fokus zeigt sich, daß es genau diese Mitte Europas ist, die Präsident Putin bombardieren läßt – jegliche Art von Mitte. Die immer wieder erst auszuhandelnde des Kontinents als stabiles Ost-West-Bündnis, die demokratische Mitte der Gesellschaften seiner Staaten, Europas fragile Mittlerposition in der Welt.
Seit dem 24. Februar 2022 geht ein Beben durch den Kontinent, dessen Schockwellen bis an die äußersten Ränder reichen. Rußlands Krieg gegen die Ukraine hat sich für Europa als eine geopolitische Katastrophe erwiesen. Der schiere Schrecken der Bombardements, die humane Tragödie der Zivilbevölkerung führte anfangs sogar zu einer gewissen Sprachlosigkeit der Politik. Verschiebungen, die sich dann abzeichneten, lagen vor allem in einer unbürokratisch geregelten Flüchtlingshilfe, aber auch in einer engeren strategischen Allianz der indirekt Mitbedrohten. Ehemalige neutrale Staaten wie Schweden und Finnland ersuchen nun um den Beitritt in die NATO. Perspektivisch könnte das eine Chance für ein geeinteres Europa sein und nicht nur der Beginn einer neuen Blockkonfrontation.
Seit mehr als 20 Jahren ist die Russische Föderation unter Putins Führung in Kriege verwickelt, die massenhaft Flucht und Vertreibung zur Folge haben. Millionen Menschen strömen nach Westeuropa, um sich vor Raketenbeschuß und Luftangriffen auf Städte in Sicherheit zu bringen. Mit dem Eingriff in den Syrien-Krieg, bei dem russische Streitkräfte mehr Zivilisten ermordeten als die Terror-Armee IS, und dem Stellvertreterkrieg im Donbas seit 2014 war eine neue Stufe bewaffneter Einmischung in extraterritoriale Konflikte erreicht. Der Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 stellt den vorläufigen Höhepunkt dar. Eine besonders schmutzige Art der Kriegführung, bei der vor allem zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser und Bahnhöfe ins Visier geraten, selbst Atomkraftwerke nicht verschont werden, scheint dabei das Markenzeichen. Dazu gehört auch die Verrohung, die sich in Massakern an Unbewaffneten zeigt, in der Belagerung und Ausräucherung ganzer Städte (Mariupol, Sjewjerodonezk, Bachmut). Das Ergebnis aber ist immer dasselbe, und es ist einkalkuliert: Angst und Schrecken unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, jede Intervention von außen durch Einschüchterung zu verhindern, notfalls mit der Androhung von Nuklearschlägen.
Wie bei dem deutschen Überfall auf Polen 1939 handelt es sich um einen Krieg ohne Kriegserklärung, aber mit fadenscheiniger Begründung. Hitler sprach von den »Einkreisern« England und Frankreich, denen er mit einer Besetzung Polens zuvorkommen mußte, Putin führt je nach Zielpublikum die Osterweiterung der NATO als Grund für seine »Spezialoperation« an oder die Machtübernahme der Ukraine durch »Nazis« und Kollaborateure des Westens. Der wahre Antrieb war damals wie heute derselbe: eine Politik des Revanchismus und der historischen Revision, Krieg im Namen der Großmachtinteressen einer gekränkten, abgehängten Nation.
Achtung, Europa! möchte man mit dem Titel einer Rede Thomas Manns aus dem Jahr 1936 warnen. Darin wird einem Europa, das mit seiner allzu konzilianten Politik gegenüber Hitlerdeutschland seine Balance zu verlieren drohte, ein Fanatismus vor Augen geführt, der Scham und Zweifel nicht kennt. Und dann kam die berühmte Formel, mit der Thomas Mann, der selbst eine Zeitlang gezögert hatte, sich zum ersten Mal deutlich auf die Seite der Faschismus-Gegner stellte: »Was heute nottäte, wäre ein militanter Humanismus …« – und das war sie, die dringend notwendige Erklärung. Oder in den Worten Gerd Koenens, der als ausgewiesener Kenner den sogenannten Russland-Komplex der Deutschen schon seit langem beobachtet und beschrieben hat: »Aus all diesen Gründen ist Neutralität in diesem Krieg keine Option mehr. Es geht um Entscheidungen, denen wir nicht länger ausweichen können und die uns – oft in betont undiplomatischer Weise – von den Angegriffenen auch abverlangt werden.«
Denn Putins blutiges Abenteuer in der Ukraine hat auch uns in eine Welt der politischen Erpressung hineingerissen, in eine trübe Sphäre der Geschichtsfälschung, der lügenhaften Rhetorik, des verordneten Gedächtnisschwunds. Die Gefahr ist groß, daß wir Europäer uns in der neuen Absurdität einrichten, die uns die Herren im Kreml diktieren. Putin zwingt uns mit seiner Reise in die Vergangenheit ein Leben nach absurden Maßstäben auf, vollkommen unpassend für die globalisierte Welt des 21. Jahrhunderts. Sanktionen statt Ausbau der Handelsnetze, Cyberkrieg statt Diplomatie, Propaganda statt Aufklärung, Aufrüstung, wo Abrüstung längst das Gebot der Stunde war usw. Vom sinnlosesten aller Kriege (»the most senseless war in our history«) sprach ein junger Moskauer Soziologe, Grigori Judin. In ihm zeigt sich die Saat des russischen Nihilismus – nichts anderes verbirgt sich hinter der Ablehnung echter demokratischer Prinzipien – als eine große gähnende Leere, die mit politischen Phrasen und Medienlügen zugekleistert wird.
Der Sinn des Ukrainekrieges steht und fällt mit der Vorstellung davon, was die Herrschaftsform des Putinismus überhaupt ist. Eine vom Geheimdienst gesteuerte Scheinparteien-Demokratie, eine mafiöse Rohstoff-Despotie, ein Zarismus für das 21. Jahrhundert, in dem Soldaten Leibeigene sind und politische Gegner in Straflagern verschwinden wie zu Dostojewskis Zeiten? Dieser Krieg wird geführt, um dem zivilgesellschaftlichen Wandel in Rußland vorzubeugen, den als »Farbenrevolutionen« denunzierten Aufbrüchen in den Nachbarländern Osteuropas und der ehemaligen Sowjetunion das stählerne Grau eines neuen Imperiums entgegenzusetzen. Der Despot nötigt ein ganzes Volk, er verlangt ihm Entscheidungen ab, die es nie hat treffen wollen. Es geht darum, die Macht nach innen zu festigen, die Bevölkerung durch Aktionismus zu hypnotisieren, sie zur Anpassung zu zwingen. Ganz sicher ist der Putinismus eine pathologische Herrschaftsform, der die Russen krank macht, sie in einen moralischen Sumpf hinabzieht. Ein kleiner KGB-Offizier, in den achtziger Jahren in Dresden im Einsatz, hat nun ein Volk von 143 Millionen in sein Verschwörernetz verstrickt …
Einen ganzen Teil meines Lebens habe ich mit diesen Gespenstern verbracht. Für eine Weile schienen sie gebannt, beinah verschwunden zu sein, nun sind sie wieder da und bedrohen die Weltordnung, »mitten im Herzen von Europa«.

Kerstin Preiwuß: Wo liegt die Mitte Europas?
Mitten gibt es viele, schon, wenn man nur ans Vermessen denkt, wird es schwierig, je nachdem, ob mit oder ohne Inseln. Stanisław Mucha hat alle ihm bekannten bereist, warum schauen wir uns nicht einfach seinen Film Die Mitte an? Wir könnten von hessischen Gartenzwergen in polnische Dörfer und weiter ins Litauische bis in die Ukraine reisen und überall Denkmäler fotografieren. Aber Vorsicht, selbst der Mittelpunkt der EU verschiebt sich gerade wieder, aus dem Landkreis Aschaffenburg um 70 Kilometer weiter auf einen Acker in Gadheim, die ersten Flaggenmasten stehen schon. »Das ist sie angeblich, aber in Wirklichkeit ist sie woanders«, wie bei Celans Geburtshaus, das liegt auch gegenüber dem restaurierten Gebäude, das die Gedenktafel trägt.
Also am besten erst gar nicht hinein ins geopolitische Gefüge, damit wir nicht gleich wieder bei der Curzon-Linie landen, oder, wenn es ein wenig mehr von oben kommen soll, beim Eisernen Vorhang. Die Spalte auf Island fällt einem da ja auch nicht als Erstes ein, als Ort des Thingvellir, des womöglich ältesten Parlaments der Welt.
Wenn es denn sein muss, kann man auch eine KI alle zwischen den europäischen Partnerstädten bestehenden Verbindungen als Linien berechnen lassen und dann auf den Moment ihrer größten Verdichtung setzen. Hier liegt dann die Goldene Mitte, von der ausgehend wir keine Legenden mehr hinzunehmen haben, selbst wenn sie auf Napoleon zurückzuführen sind, der ausgerechnet mal Braunau als Mittelpunkt Europas auserkoren haben soll. Lieber irgendeine Koordinate, wo sich vielleicht gerade der Hund kratzt, von Google Street View zufällig ins Bild gesetzt. Denn wenn ich mich durch YouTube klicke, erfahre ich, dass ich sowieso in der gemäßigten Zone lebe, in der man überall Getreidefelder sieht, und ein Blick auf die Karte genügt, um zu begreifen, dass wir alle Nachbarn sind und uns immer ähnlicher werden. Es ist gut zu erkennen, wie das Heilige Römische Reich zerfällt und sich dann erstmal nicht mehr so richtig viel in der Mitte tut, bevor sie nach dem Ersten Weltkrieg wieder in Bewegung gerät und erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ruhiger wird, bis das zerfallende sowjetische Großreich wieder Bewegung in die Karte bringt.
Das Eigentliche sind doch die Ideen. »Europa ist kein Ort, sondern eine Idee«, heißt es; versuchen wir es also damit, es gibt ja einige davon. Der Nabel der Welt. Die gemäßigte Zone. Hochkultur. Abendland. Arkadien. Und kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, die Kresy, die Steppe? Erst da, wo keine Aprikosenbäume mehr wachsen, fängt Russland an, schreibt die ukrainische Dichterin Ljuba Jakymtschuk in ihrem Gedicht Die Aprikosen des Donbas. So kommen wir nicht weiter. Schließlich wurde Europa auch überall hingetragen, war zumindest eine Zeitlang auch auf der Suche nach El Dorado und hat mit Millionen Viren im Gepäck den Ansässigen vor Ort einiges beigebracht. Abschied von El Dorado (Naipaul) ist ein schönes Beispiel europäischer Kultur, eine Insel zu unterwerfen, deren Bewohner zu vernichten und eine »auf Profit zielende Gesellschaft« zu gründen, in der die Menschen zur Ware werden.
Gehen wir es doch mal mythisch an und versuchen wir es mit dem »Nabel der Welt«, derwar schwierig für die Königstochter; zwar gebar sie noch, nachdem der Stier, dem sie Girlanden umgehängt, sie erst entführt und dann unter Platanen oder im Weidendickicht vergewaltigt hatte; aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn nicht. Auf der Suche nach Europa nahmen sich ihre Brüder Land und gründeten Städte, indem sie Kühen folgten und dort, wo diese sich niederließen, so lange aufeinander einschlugen, bis nur noch wenige übrig waren. Europa ist gut zu beweiden, voller Kuhaugen und Kriege, mit welchem fängt man nur an.
Your Values, jetzt wird es schwierig, die Balance zu halten, dass man mal Wind of Change in den Meghalaya Hills a capella vorgesungen bekam, unter dem Foto des Maharadschas, der erst Mussolini und dann Churchill traf, reicht bei Weitem nicht. Auch die Hymne auf den Minenhund und die spontanen Chöre in Metrostationen, die bloße Präsenz von als auch der Umgang mit Musik in Situationen der Not reicht nicht immer, um sich über Angst und Schrecken zu erheben. Gentle World, hier liegt dein blinder Fleck: die fehlende Erkenntnis, »dass die Wahrheit nicht immer unbedingt irgendwo in der Mitte zu suchen ist« (Jurko Prochasko / FAZ, 1.1.2023). Also besser keine Linien, Symbole, Werte mehr. Oder, noch besser, sich andere Symbole suchen, damit wir wieder auf Ideen kommen, ich fange gleich mal eine Liste an:
statt der Ilias als erstem Weltkrieg der Geschichte den Euromajdan,
statt des Völkerschlachtdenkmals Paper Trails und Stolpersteine,
den Verein bloodland e.V. zur Aufarbeitung der kontaminierten Landschaft,
die Farbe Gelb im Ginster, in Sonnenblumen und in einer zerstörten Küche,
Tschernobyl als Stern aus der Offenbarung des Johannes,
Przewalski-Pferde in Askanija-Nowa und Unicorns in Uniforms und
ein Wisent aus dem Urwald von Białowieża anstelle eines Stiers aus Kreta,
der Valzhyna Mort in der Ewigen Stadt plötzlich im Weg stand, »this heaviest European mammal, this fantastic animal, its own angel of history, its own monster, its own pope, its own Zeus, beautiful beast at all«. Sein Schnauben mag sie kurz abgelenkt haben von den Listen der namenlosen Toten, die sie mithilfe der englischen Sprache der Welt wieder hinzufügte.
Unter den Platanen oder im Weidendickicht fehlt dem größten Landsäugetier Europas der Platz, ihm, der einst überall auf dem Kontinent bis auf die britischen Inseln verbreitet war und dann ausstarb. Seit 40 000 Jahren an Höhlenwänden zu sehen oder als Skulptur für die Hand gemacht, überlebte der Wisent nur im Wald von Białowieża, dem letzten Urwald mitten in Europa, seit Jahrtausenden sich selbst überlassen, einzig verbliebener Rest jener Flachlandwälder, die einst weite Teile des Kontinents bedeckten. Mittlerweile arbeitet man wieder an seiner Auswilderung und längst gelangten ein Muttertier und zwei jüngere Kühe in einen Wald nahe Canterbury. Allein die Freilassung eines Bullen aus Deutschland, der sich der Herde anschließen soll, verzögert sich aufgrund der Post-Brexit-Bürokratie. Bald gibt es ihn auch wieder in den Niederlanden, in Dänemark, in Frankreich, im Spreewald, Harz oder Pfälzerwald, wobei noch offen ist, ob man die Tiere dort freilässt oder darauf wartet, dass sie von Osten her selbst einwandern.
Vielleicht lässt man also das Messen einfach sein und sucht sein Gleichgewicht stattdessen in den Resten des zu Schützenden von etwas, das man zu schützen hat, und für das man, um es zu wahren, den eigenen blinden Flecken auf den Grund gehen muss. Sein Erhalt ist mit besonderen Herausforderungen verbunden, etwa einer Änderung der Blickrichtung oder einer Abkehr von der gewohnten Fokus-Hintergrund-Projektion. Um zu bestehen, eignet sich die Methode Staffelstab, und am besten übergibt man ihn jenen, die wissen, was es bedeutet, um das zu kämpfen, was man zu schützen hat. Nur bitte keine Denkmäler.

Cécile Wajsbrot: Im Auge des Zyklons
1
Es gibt eine Kartenserie, die Verschiebungen der geographischen Mitte dessen zeigt, was die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, dann die Europäische Gemeinschaft war und jetzt die Europäische Union ist. Die Mitte wandert von Dorf zu Dorf; es sind unbekannte Dörfer mit bezaubernden Namen, mal französisch, mal belgisch oder deutsch: Frampas, Fougerolles, Saint-Clément, Viroinval, Gelnhausen, Westerngrund und, seit dem Brexit, Gadheim in Bayern. Diese Mitte verschiebt sich ein wenig weiter nach Osten, nach Norden oder Süden, aber bis heute bleibt sie in einem der Gründungsländer, dort, wo ursprünglich Westeuropa ist.
Unsere Wahrnehmung von Europa, vom europäischen Raum ist allerdings keineswegs geographisch. Sie ist intuitiv und historisch zugleich und beruht auf doppelter Erfahrung durch individuelles und kollektives Sein. Zwar berechnen Algorithmen genauestens, auf welche Weise bedeutende Ereignisse – etwa die deutsche Wiedervereinigung oder der schrittweise Beitritt der osteuropäischen Länder zur Europäischen Union – auf die Festlegung einer geographischen Mitte einwirken. Doch berechnen, wie diese Ereignisse die fragilen Gleichgewichte erschüttern, auf die subjektive Wahrnehmung einer Mitte einwirken und die Äquivalenz zwischen »gefühlter« Mitte und tatsächlichem Mittelpunkt des Interesses austarieren – analog zum Unterschied zwischen gefühlter und realer Temperatur neuerdings in der Meteorologie –, das können Algorithmen nicht!
2
Von November 2022 bis Anfang Mai 2023 zeigt das Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid die Ausstellung In the Eye of the Storm: Modernism in Ukraine, 1900–1930s. Nahezu 70 Gemälde stammen aus dem Ukrainischen Nationalmuseum, ein kleiner Teil aus den eigenen Beständen des Madrider Museums. Die Namen der Maler waren uns, zumindest in Frankreich, bisher unbekannt: etwa Oleksandr Bohomazow und Wiktor Palmow, oder auch viel bekanntere wie Kasimir Malewitsch und Sonia Delaunay, beide in Kyjiw geboren. Wenngleich ihr Werdegang im Wesentlichen außerhalb der Ukraine verlief, so sind sie nun gewissermaßen ihrem Herkunftsland zurückgegeben.
Seit dem schrecklichen Krieg, den Putin gegen die Ukraine angezettelt hat, konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit wiederum auf eine Region, für die sich im westlichen Europa, wo ja die geographische Mitte der Union liegt, wenige interessierten. Statt der Namen jener Maler hören oder sagen wir Städtenamen, Butscha, Mariupol, Cherson, Saporischschja, verbinden sie mit den von der russischen Armee begangenen Massakern. Namen, die nun leider in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und auf die Titelseiten der deutschen, französischen, spanischen oder polnischen Zeitungen rücken und in diesem Europa, dem es so schwerfällt, sich zu einigen, zumindest eine Einheit verwirklichen – die geeinte Aufmerksamkeit.
Die Ausstellung von Madrid dokumentiert eine Epoche von Kriegen und Revolutionen, Massakern, Unterdrückung und Hungersnot. Doch diese grausamen Szenen sieht man nicht auf den Gemälden. Vor allem sind sie Forschungen über Abstraktion in Farbe und Form, die auf besondere Weise mit den grausamen Ereignissen, die sich parallel abspielen, in Verbindung stehen. Kunst ist vor allem eine Suche nach Formen, um zu übersetzen, was geschieht, gewiss, aber in eine andere Sprache, in eine Sprache, die nicht nachbuchstabiert.
Unter dem Auge des Zyklons haben zwei Lastwagen die Gemälde aus Kyjiw geholt, auch mit der Mission, sie vor den russischen Cruise-Missiles in Sicherheit zu bringen, sie zu retten. Zehn Stunden Wartezeit an der polnisch-ukrainischen Grenze, verschiedene Botschafter setzten sich ein, endlich freie Fahrt; aber der Weg nach Madrid war noch lang.
Im Auge des Zyklons: Ist es das Thema der Ausstellung oder sind es die Bedingungen, unter denen diese vorbereitet oder vielmehr improvisiert wurde? Seit sechs Jahren wollte Kurator Konstantin Akinscha eine Ausstellung zur ukrainischen Kunst machen. Aber die hatte niemanden interessiert. Sollte also der Krieg ein schrecklicher Kunstagent sein? Denn die Namen rufen andere Namen herbei und plötzlich verändert sich etwas, die Geographie verschiebt sich, die Aufmerksamkeit bleibt haften, bevor sie sich wieder abwendet …
3
Das Auge des Zyklons, ursprünglich eine windstille Zone in der Mitte von Wirbelwinden bezeichnend, hat sich ins Gegenteil gewendet, wurde Synonym für den Sturm selbst. Die Mitte, die das Ganze meint, so lautet die Definition einer Stilfigur, die Synekdoche – ein Segel für ein Schiff und die Ukraine für Europa. Die Ukraine, im Auge des Zyklons, steht nun für jenes Europa, für das die Europäische Union selbst kaum noch steht, dort, wo Ideen verteidigt werden, an die wir uns nur schwer erinnern oder die für viele zu leeren Worthülsen geworden sind, zu Wörtern, die nichts mehr bezeichnen. Wie Demokratie. Wie Freiheit. Dort uns so fern und nun so nahe gerückt, dort, wo gestorben wird, damit die Leere sich wieder füllt, damit das, was wir hier ausriefen, ohne daran zu glauben, wieder einen Sinn bekommt.
Von Madrid werden die Kyjiwer Bilder nach Köln wandern, danach vielleicht anderswohin. Immigranten, Emigranten, wie manche von denen, die früher ins Museum gingen, um diese Bilder anzuschauen, in Kyjiw, zu Hause, vor dem Krieg ... Jetzt irren sie durch Europa auf der Suche nach einem Hafen, nach einem Aufnahmeort, einem Halt in ihrem Exil. Denn im Grunde ist ja die Mitte, ist das Zentrum immer in Bewegung und die Zukunft immer ungewiss.
Übersetzung aus dem Französischen von Esther von der Osten
Jurko Prochasko: Meine Leben in Mitteleuropa
Die Idee von Mitteleuropa hat langlebige Spuren in mir hinterlassen. Diese Spuren machen mehrere Leben aus. Ist es ein Wunder, dass ich bereit war, für jedes Leben im Dienst dieser Idee nur einen Namen zu gebrauchen? Mitteleuropa. Und warum war ich nicht bereit, diesen Namen aufzugeben?
Anfangs sah ich Mitteleuropa in enger Verbindung mit Galizien, unserem Galizien: Relikt und Residuum von Altösterreich, von daher Westen und Europa schlechthin; vor allem aber Reservoir von Ideen und Inhalten. Ich war stolz und glücklich, dass wir in der Ukraine ein unverfälschtes Stück echtes Mitteleuropa besaßen. Das war unser Alibi, unsere Legitimation, unsere Rechtfertigung und, mehr noch, die Grundlage unseres Anspruchs.
Als genuine Erbschaftbefähigte des K.-u.-k.-Vermächtnisses in der westlichen Ukraine verstanden wir uns auch darauf, die östliche Ukraine nach dem Modell von Mitteleuropa zu transformieren und zu reformieren. Darüber hinaus beanspruchten wir Mitteleuropa als Argument, damit die seit 1991 unabhängige Ukraine den gleichen Weg gehen kann wie die sogenannten »klassischen und allgemein anerkannten« mitteleuropäischen Länder: Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Slowenien. Warum sollten wir nicht auch das gleiche Recht haben? Und weshalb sollten für uns andere Kategorien gelten, um die Trajektorien des postsowjetischen Raums abzustreifen und die imperialen Ansprüche des scheintoten Imperiums dazu? Das baltische Kunststück gelang uns aber nicht. Wir wurden kein EU-Kandidat. Für uns sah man eine Ostpartnerschaft vor, die implizierte, dass wir genau dort zu verbleiben haben, woraus wir uns doch so leidenschaftlich zu befreien und zu emanzipieren trachteten. Diese Etappe war mit einer großen Enttäuschung verbunden. Diese Enttäuschung ist jetzt vom Tisch.
Doch die »echten« Mitteleuropäer, die zunächst so viel Wert auf ihre besondere Zugehörigkeit zur EU legten, verloren indes schnell das Interesse daran, nachdem das ersehnte Ziel erreicht war. Mit der Zugehörigkeit zum Klub, der allein über das wirkliche, echte Europa bestimmt, verlor für sie die Mitteleuropa-Idee jeglichen Wert. Mitteleuropa: ein Übergangsprojekt mit befristetem Nutzen; ein Mittel zum Zweck und ohne Ziel. Gleichzeitig war zu hören: Das Konzept habe sich überlebt und gehöre jetzt – abgesehen von einem kleinen antiquierten Kreis hoffnungsloser Nostalgiker – ins Archiv der Ideengeschichte.
Da ergriff mich die Lust, die Mitteleuropa-Idee mit neuem Leben zu füllen. Vielleicht, um auch andere zu inspirieren; vielleicht, um der Idee im eigenen endlichen Leben Unsterblichkeit einzuhauchen – gutartiger Proporz vom Bewusstsein des persönlichen imperialen Erbes, gepaart mit der Lust, sich zu emanzipieren. Also sowohl das persönliche Gezeichnet-Sein durch ein vergangenes europäisches Imperium und die eigene nationale Identität in einer Schicksalsgemeinschaft anzuerkennen wie auch das Dazwischen: die freiwillige Nicht-Zugehörigkeit zu jeglichen Großmachtprojekten in West und Ost.
Die Mitte eben. Eine besondere Mitte. Eine so empathische wie verstehende Mitte. Die Mitte als Folge von Vermittlung durch Vermittler, die ausgestattet sind mit der Fähigkeit, unparteiisch zwischen dem Westen und Osten von Europa zu vermitteln. Vermittler, die Empathie nicht mit Identitätsverlust verwechseln. Vermittler zwischen den Weltanschauungen, Ideologien, Lebensweisen. Und, nicht zu vergessen, Vermittler zwischen den unterschiedlichen Arten von Humor. Wahre Mittler und nicht bemitleidenswertes Mittelmaß. Vermittler mit Persönlichkeit, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, erworben aus der historisch erlernten oder geerbten Fähigkeit, die geistige Mitte zu schützen und Extremen und Extremismen standzuhalten. Für die Mitteleuropäer im heutigen EU-Europa ist die geistige Mitte und die Gabe zur Vermittlung überlebenswichtig angesichts der Vielzahl konträrer oder widersprüchlicher Interessen, Traditionen und Vorstellungen.
Der neue Mitteleuropäer wurde für mich, in meinem zweiten Leben, ein Europäer der tiefen Einsicht in die existenzielle Notwendigkeit der EU, ausgestattet mit der Fähigkeit, die Lebenslust der Gemeinschaft aufrechtzuerhalten und auszutarieren. Vor dem Hintergrund offensichtlicher Ermüdungserscheinungen in der EU, die zu einem Verfall, wenn nicht zum Verlust des europäischen Eros führen, entdeckte ich eine Hypostase des Mitteleuropäers: Die Wandlung zu einem Menschen, der unmittelbar und existenziell in europäischen Belangen steht, berührt dessen innere Mitte und bestimmt sie neu.
Diese unmittelbare Mitte braucht Europa dringend für die Neubestimmung des Eros. Es ist doch so, dass dem EU-Europa das weiter östlich gelegene und sich nach Zugehörigkeit sehnende Europa – die Ukraine, Moldawien, Belarus – herzlich egal war: ohne europäischen Eros und unempfänglich für seine Aura. Dieses saturierte, instinktlose EU-Europa, an sich selbst müde und bereit zum Aufgeben, verkannte 2013/14 im Euromajdan die Revolution der Würde. Aus meiner Sicht verstand das normative Europa weder seine eigenen Kardinaltugenden noch, dass genau jene Tugenden – die Freiheit, Emanzipation, Pluralität, Solidarität – von der ukrainischen Revolution vorgelebt und getragen wurden.
Für mich war klargeworden: Mitteleuropa ist jetzt die ganze Ukraine. Auf diese ortsunabhängige Freiheit hätte man auch früher kommen können! Begriffe wie Mitteleuropa beziehungsweise Zentraleuropa (Milan Kundera) sind zwar geographisch im osthabsburgischen Mitteleuropa angesiedelt, bergen aber als Idee und Vorstellung ungeheuer kreatives Potenzial. Die Idee von Mitteleuropa aufzugeben, stand für mich außer Frage. Nicht nur wegen ihrer unendlichen, kostbaren Erneuerungsenergie. Schließlich wird diese Idee nicht nur für den Fortbestand der Ukraine dringend benötigt, sondern auch für das neue Europa in statu nascendi.
So kam für mich eine neue, eine goldene Zeit, in der Europa mir völlig exterritorialisiert und reihenweise neuformuliert erscheint: einmal, um die Idee von Mitteleuropa zu revitalisieren; zum anderen, um mit den neuen Konnotationen und Qualitäten die Idee von Europa nutzbringend zu erweitern. Dem verwandt ist eine andere, vergessen geglaubte Tugend des Mitteleuropäers: seine Einsicht in die Notwendigkeit und die Fähigkeit, Komplexitäten und Ambivalenzen zu ertragen und aufrechtzuhalten, ohne in zerstörerische Vereinfachungswut zu verfallen. Diese neue Lesart von Mitteleuropa können wir gut gebrauchen. Doch Achtung! Beide Aspekte bitte keinesfalls verwechseln mit einem Relativismus in Wahrnehmung und Einschätzung von Wahrheit; ebenso wenig mit der Ansicht, dass die Wahrheit eh immer irgendwo in der Mitte liegt. Führten die Verkennung und die Relativierung von Gefahren und Tendenzen bei der Einschätzung des Putinismus seit gut einem Vierteljahrhundert nicht zu allzu dramatischen Entwicklungen?
Womit wir endgültig beim Krieg angelangt sind. Oder anders gesagt: bei den Erkenntnissen, die aus diesem Krieg gewonnen werden können. Klar ist, dass es seit dem dramatischen Aufprall wieder Ost und West gibt. Klar ist auch, dass der Krieg nicht erst am 24. Februar 2022 begonnen hat, sondern dass er sich lange davor anbahnte. Deutlich geworden ist aber auch, dass nach einem Jahr des Krieges wieder über Mitteleuropa gesprochen wird. Vornehmlich die mitteleuropäischen Gesellschaften des einstigen neuen Europas in der EU stehen bedingungslos und unmissverständlich zur Ukraine, ebenso Großbritannien; während das einstige, sogenannte alte Europa jegliches Ansehen und moralische Führungsrecht zu verlieren drohte: wegen seiner Zögerlichkeit, Unentschlossenheit und wegen seiner Kompromissbereitschaft. Wohl aufgrund der Neigung, allzu unfreiwillig in die Umkehrfalle zu geraten. Mitteleuropa gibt es, mitten in Europa, sogar in seinem selbstausgemachten Kernstück, der EU. Auch hier haben die Mitteleuropäer ihre Schuldigkeit getan, weil sie die Westeuropäer aufmerksam machten.
Womit weitere Tugenden der Mitteleuropäer zutage treten: die Deutungskunst und das Übersetzungsvermögen. Deuter und Übersetzer fanden sich ja auch außerhalb der EU, in der unbenannten Mitte Europas, die sich auf dem Majdan Luft machte. Der Euromajdan 2013/14 war doch schon die Erweiterung Mitteleuropas auf die gesamte Ukraine. Nach der Krim-Annexion im Jahr 2014, der Besetzung des Donbas und schließlich seit dem Krieg gegen die Ukraine haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, wie mühsam die Majdan-Epiphanien zum alten Europa durchdrangen, wie verkehrt sie dort ausgelegt wurden, wie wenig Verständnis dem Geschehen in der Ukraine entgegengebracht wurde; und wie groß und unverbrüchlich demgegenüber die Bereitschaft war, Russland nicht nur zu »verstehen«, sondern weiter mit ihm zu kooperieren – über unsere Köpfe und Leben hinweg. Währenddessen wurden wir zu Mitteleuropäern: auch als Deuter und Übersetzer, die sich darum mühten, dem Westen Russland zu erklären und die eigenen Verblendungen.
Jetzt müssen wir alle Mitteleuropäer werden, eine gemeinsame Mitte finden; zu Mitteln finden, um die Mitte zu finden in diesen düsteren Zeiten. Jetzt wird das Schicksal Mitteleuropas auf den Schlachtfeldern der Ukraine entschieden. Ein Mitteleuropäer ist heute ein jeder, der inmitten europäischer Angelegenheiten lebt und denkt und fühlt, inmitten des europäischen Engagements. Wir werden es brauchen, dieses neu gedachte Mitteleuropa als geeintes Europa – wegen Europa, für Europa schlechthin.
Es ist nun an der Zeit, die Idee von Mitteleuropa exterritorial zu konzipieren – losgelöst von jeglicher Geographie, von örtlicher und räumlicher Gebundenheit. Denn Mitteleuropa kann überall entstehen und bestehen: aus der Balance von Leidenschaft und Handeln. Und Mitteleuropäer kann jeder sein, der für die europäischen Belange einsteht, der den Zweck nicht vom Ziel trennt und der seine geistige Mitte wahrt.
So gesehen ist die Idee von Mitteleuropa nun unsterblich – wie das himmlische Jerusalem, wie Rilkes Engel der Unsichtbarkeit. Oder, um Adam Zagajewski zu paraphrasieren – Mitteleuropa ist überall, wo es willens ist, zu sein.
Europäische Allianz der Akademien

Agenda 2023
Am 16. Dezember 2022 haben die Mitglieder der Europäischen Allianz der Akademien auf ihrer Tagung in der Berliner Akademie der Künste die „Agenda 2023“ verabschiedet, die in sieben Schritten zu einem neuen Selbstverständnis Europas aufruft und die zur Grundlage der Allianz-Aktivitäten der kommenden Jahre erklärt wurde.
European Alliance of Academies
Agenda 2023
1) advocating jointly for artistic freedom, namely through immediate reaction against censorship, political repression, polarization of political and cultural debates, nationalism and any kind of anti-democratic tendencies
2) striving for more dialogue and impact of the cultural sector on the European agenda, namely through communication of the EAoA members with political representatives on national and European levels, as well as through joint programming actions
3) working together to foster the dialogue and collaboration between the members of the Alliance, namely through enhancing the mutual exchange of performances, exhibitions and cultural debates, as well as through residencies, internships, etc between the members
4) committing to an active authorship of the younger generation and its involvement in the EAoA, namely throughcreating meeting possibilities for a continued dialogue at the Alliance’s events, giving a platform to the visions and ideas of young colleagues and listening to their experience in international communication and networking for the defense of artistic freedom and democratic values
5) raising awareness for democratic values being core elements of the European identity and its diversity, and at the same time…
6) …drawing attention to the invisible borders which are still dividing Europe, through a stronger focus on common visions and projects on art and culture of Western/Central/Eastern/Northern/Southern cultural institutions for various target groups (professional public, general public, young generation, politicians, media, etc.)
7) taking responsibility through art and culture to respond to the challenges of our times, such as
- climate crisis,
- migration,
- social, racial and gender inequality

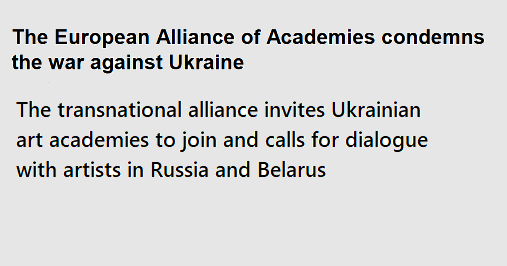
Europäische Allianz der Akademien verurteilt den Krieg gegen die Ukraine
Die Europäische Allianz der Akademien hat sich in einer Erklärung zum Ukraine-Krieg für die Aufrechterhaltung des Dialogs ausgesprochen. Sie setzt auf die Möglichkeiten des kritischen Dialogs. Außerdem weitet sie ihren Aktionsradius erstmals über die Grenzen der EU aus. So werden ausdrücklich Künstler und Akademien in der Ukraine eingeladen, der Allianz beizutreten. Das Gleiche gilt für oppositionelle Künstler und Einrichtungen aus Russland und Belarus. Statement vom 7.3.2022: "[...] Die Europäische Allianz der Akademien verurteilt den Krieg Putins und erklärt sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine. Die Europäische Allianz der Akademien lädt ukrainische Kunstakademien und Kulturinstitutionen dazu ein, dem europaweiten Bündnis beizutreten. Auch russische und belarussische Künstlerinnen und Künstler sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die unter großen Risiken ihre Stimme gegen den Krieg erheben, sind in der Europäischen Allianz der Akademien willkommen. Ihnen gilt unsere Solidarität. [...]" Weiterlesen / englische Fassung
Konferenz "The Power of Art"
Die Konferenz der European Alliance of Academies unter dem Titel The Power of Art. Defending a Transnational Understanding of European Culture fand vom 2. bis 3. Dezember im Circulo de Bellas Artes de Madrid statt. Analysiert werden sollten die Potenziale künstlerischer Kooperation und die unterschiedlichen kulturpolitischen Ansätze in Europa und deren Einfluss auf Kulturinstitutionen und damit auf die Kunstfreiheit. Für die Sächsische Akademie der Künste nahmen der ehemalige Präsident Holk Freytag und der Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Psychoanalytiker Jurko Prochasko aus der Ukraine teil.
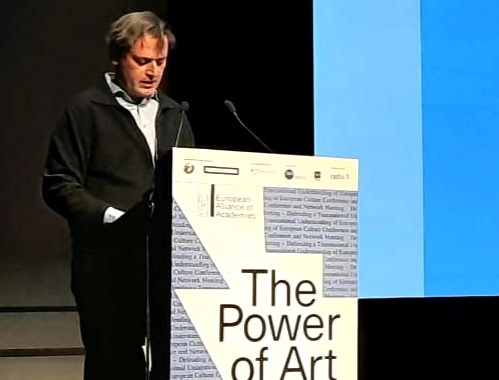
Jurko Prochasko markierte mit seinem Vortrag den Abschluss der Konferenz. Er fragt, was geschieht, wenn politische Radikalisierung auf Kunstfreiheit trifft: "Gibt es überhaupt noch eine Freiheit in einer radikalisierten Situation? Ist die Freiheit, eine radikale Position zu beziehen, nicht auch eine (heilige) Freiheit der Kunst? Oder bedeutet die wahre Freiheit nicht das Heraustreten aus der radikalisierten und radikalen Situation? Oder liegt die Freiheit im Ignorieren, im Eskapismus, in der inneren Emigration, in der Kunst für die Kunst, im Ästhetizismus?"
Den vollständigen Vortrag können Sie hier nachlesen.
Nachdenken über Europa

Auf der Mitgliederversammlung am 7. Mai 2021 haben sich die Mitglieder der Akademie mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Zukunft Europas zu einem Schwerpunktthema zu machen. Dem gingen eine Reihe von Überlegungen voraus, die Holk Freytag im Folgenden zusammengefasst hat. PDF
Mitglieder der Sächsischen Akademie der Künste wurden gefragt: Was bedeutet in Zukunft „europäische Integration“? Wo liegt Europa? In Paris? In Brüssel? In den Mittelmeerstaaten? Bei den Višegrad-Staaten? Welche Rolle können Kunst und Kultur, Künstlerinnen und Künstler bei der Diskussion dieser Fragen spielen? Statements dazu finden Sie auf dieser Seite von Stephanie Buck, Durs Grünbein, Wolfgang Holler, Wolfgang Kil, Romuald Loegler, Jurko Prochasko, Annette Schlünz, Ingo Schulze und Bohdan Tscherkes.
Wolfgang Kil: Europa – wie weiter…
"Es war kein Zufall, dass der Redebeitrag von Annette Schlünz auf unserer letzten Mitgliederversammlung wie ein Weckruf wirkte. Sie berichtete von Beobachtungen beiderseits des Rheins bei Strasbourg während der Pandemie-bedingten Reisebeschränkungen. Dass die deutsch-französische Grenze, das immer wieder zitierte Musterbeispiel europäischen Zusammenwachsens, sich offenbar doch nur pro forma erübrigt hatte und im so nie vorhergesehenen Krisenfall sich über Nacht und sehr effizient reaktivieren ließ, hatte zu den verstörenden Nachrichten am Rande der täglichen Pandemie-Berichterstattung gehört. [...]" PDF
Wolfgang Holler: Eine neue, gemeinsame Aufklärung tut not!
"[...] Wenn wir über uns in Europa nachdenken, müssen wir ohne Frage über Europa hinausdenken. Wir müssen uns öffnen, ohne eigene Überzeugungen grundsätzlich in Frage zu stellen. Wir müssen fragen, ob und wie Entgrenzung auch die notwendige Verortung möglich macht. Nur so können wir unsere Identität »erfrischen«.
Wir brauchen keine ängstlichen Distinktionen, keine polarisierende Kolonialismus-Debatte, keine diffamierende Rassismus-Polemik, keine emotionsgeleitete Cancel Culture. Wir brauchen keine interessengeleitete, retrospektive Konstruktion, sondern kontextbewusste Relevanz als Zukunftsplattform. [...]" PDF
Annette Schlünz: Sind wir in einer neuen Epoche angekommen?
Vor einem Jahr schrieb die Komponistin für die Akademie einen Beitrag über ihre Situation als freischaffende Komponistin im Grenzgebiet Deutschland - Frankreich und unterzieht ihre damaligen Reflexionen einer kritischen Revision. "Aus dem umtriebigen Hin und Her zwischen Schreibtisch, Conservatoire Strasbourg und vielen anderen Arbeitsorten in der Welt wurde ich plötzlich in mein Dorf Leutesheim bei Kehl verortet - die Grenze zum Nachbarland war im März innerhalb von vier Tagen nicht mehr passierbar, dann kam die Ausgangssperre auf der französischen Rheinseite." PDF
Jurko Prochasko: Mitteleuropa - Die Utopien müssen weitergehen
"Ich habe die Mitteleuropäer um ihre friedliche Revolution 1989 beneidet. Mir fehlte für die Ukraine immer dieses Gefühl. Stattdessen hatte ich den Eindruck einer quälenden Zähigkeit und Klebrigkeit der Zeit, der eben diese Zäsur 1989 fehlt. Der Preis für das Ausbleiben der Revolution war, dass in der Ukraine immer weitere Revolutionen kommen mussten, wie 2004/2005 die Orangene Revolution und dann 2013/2014 der Euromaidan. [...]" PDF
Kein Ende der Utopien, resümierte der ukrainische Autor und Übersetzer Autor Jurko Prochasko aus Lemberg/Lviv anlässlich einer Diskussion zur Frage der Zukunftsvorstellungen von 1989/90 in den mittel- und osteuropäischen Ländern. Prochasko konstatiert für die Ukraine das Ausbleiben einer Zäsur wie es sie 1989 in Ostdeutschland gegeben hat. Mehr zur Veranstaltung vom 13. Dezember 2019.
Zusammenfassung des Diskussionsbeitrags
Ich habe die Mitteleuropäer um ihre friedliche Revolution 1989 beneidet. Mir fehlte für die Ukraine immer dieses Gefühl. Stattdessen hatte ich den Eindruck einer quälenden Zähigkeit und Klebrigkeit der Zeit, der eben diese Zäsur 1989 fehlt. Der Preis für das Ausbleiben der Revolution war, dass in der Ukraine immer weitere Revolutionen kommen mussten, wie 2004/2005 die Orangene Revolution und dann 2013/2014 der Euromaidan.
Das bedeutsame Jahr für die Ukraine war nicht das Jahr 1989, wie für die mitteleuropäischen Länder, sondern das Jahr 1991, obwohl aus meiner Sicht auch da keine Wende stattgefunden hat. Wenn wir überhaupt von einer Wende sprechen können, dann kam sie 2013/2014 mit dem Euromaidan und der sogenannten Revolution der Würde. Es gab zwei große Utopien: Die große Vision einer nationalen Ukraine als souveränen Staat. Wir wollten weg von Moskau. Die ersten Gesprächspartner waren für uns deshalb die Balten, weil sie ebenfalls nach dieser Unabhängigkeit strebten. Die zweite große Utopie war Europa, der Westen. Wir waren 1945 gewaltsam von Europa getrennt. Mit dieser Erfahrung wollten wir nach 1989/1990 nach Europa zurückkehren. Paradoxerweise hatten wir keine Ahnung, was den Westen ausmacht. Wir verließen uns aber darauf, dass der Westen schon wisse, wo es langgeht und waren sicher, alles sei längst vorbereitet.
Unter den Intellektuellen, die sich auf Czesław Miłosz, Milan Kundera und György Konrád beriefen, wurde seit den 1980er Jahren die Idee von Europa zur Idee von Mitteleuropa entwickelt. Polen, Tschechien und Ungarn waren 1991 mit dem Visegráder Abkommen auf dem Weg, ihren Status als Mitteleuropa zu formalisieren. Für die ukrainischen Intellektuellen war dies ein Signal, sich ganz in den mitteleuropäischen Diskurs hinein zu begeben und sich mit Themen wie Pluralität, Toleranz, Solidarität, Vergangenheit auseinanderzusetzen. Unsere wichtigste Strategie war, alles daranzusetzen, so zu schreiben, zu argumentieren, zu sprechen und zu denken, dass nicht der Verdacht aufkomme, wir seien keine Mitteleuropäer, sondern Postsowjetmenschen. Das führte auch zu einer engen Kooperation mit den polnischen Kollegen. Zugleich wurde uns schnell klar, dass Mitteleuropa nur ein notwendiger Weg war, um in die eigentliche europäische Gemeinschaft hineinzukommen, in die wir auch unbedingt hinwollten.
Wir hatten es also mit drei großen Aufgaben zu tun: Erstens war alles zu tun, um wie die Ungarn, Tschechen, Slowaken und Polen als genuine Mitteleuropäer anerkannt zu werden. Zweitens hatten wir Mitteleuropa als Argument gegenüber Russland zu verdeutlichen, das damals unter Jelzin noch etwas anderes war als heute. Diese Chance haben wir, meine ich, verpasst. Drittens hatten wir nicht bedacht, dass unsere Vorstellungen von einem Nationalstaat in ihren Grundzügen aus dem 19. Jahrhundert stammten und sich Europa und der Westen mittlerweile auf einem ganz anderen Weg befand. Wir wollten uns profilieren, präsent sein, nicht mehr verwechselt werden, ohne zu wissen, wie dies umzusetzen sei. Das musste zum Konflikt führen.
Wir müssen damit umzugehen lernen, dass wir vom Westen nicht mit Enthusiasmus erwartet werden. Im Gegenteil, derzeit werden alte politische und kulturelle Grenzen wieder neu zementiert. Und auch unser Blick von außen auf das Europa der Europäischen Gemeinschaft hat sich verändert, eine Idealisierung vom Westen gibt es nicht mehr. Das ist eine Entidealisierung, keine Entwertung.
Für die Länder östlich der EU gilt heute noch die gleiche Agenda für die nicht fertig gewordenen Aufgaben des Aufbruchs von 1989/90. Nach wie vor bleiben die großen Fragen bestehen: die der nationalen Souveränität, die der europäischen Integration und die des Anti-Oligarchismus - so schlicht ist diese Formel. Diese Utopie von Europa ist nicht ausgeträumt, nicht zuletzt, weil wir kein besseres normatives Ideal haben, es sei denn in einer anderen Dimension.
So zeichnet sich eine Utopie ab, die diese Bezeichnung verdient, weil sie zukunftsweisend und global ist: Das ist die Utopie der Klimarettung. Sie könnte zu einer neuen gemeinsamen großen Utopie werden, die Europa künftig verbindet und bei der man aktivistisch werden und zur Tat schreiten muss.
Mitteleuropa als Konzept muss man als historisch erklären, doch dies bedeutet nicht, dass es an Produktivität verloren hat. Es wäre leichtfertig, Mitteleuropa beiseite zu legen. Der Mitteleuropabegriff sollte vielmehr neu semantisiert und vom Territorium losgelöst begriffen werden. Dann können wir Mitteleuropa anders denken: Der neue Mitteleuropäer lebt mitten in den europäischen Belangen (Inter-esse), die ihm nicht gleichgültig sind und für die er sich leidenschaftlich engagiert. Ein Mitteleuropäer kann heute derjenige sein, der sich gegen die Radikalisierung und Spaltung einsetzt, der zwischen den Extremen vermittelt und die neue Mitte sucht. Es geht um ein Europa, das mit Polarisierungen und ernsten Bedrohungen umzugehen weiß: Mitteleuropa als Europa der wiedergefundenen seelischen Mitte.
Summary of Jurko Prochasko’s discussion paper from 13 December 2019. Read More
I envied the Central Europeans for their peaceful revolution in 1989. However, I couldn’t say the same for Ukraine. Instead, I had the impression of an agonizing inflexibility and stickiness of time that lacked this turning point of 1989. The price for the absence of revolution was that Ukraine was destined to undergo multiple revolutions later on, such as the Orange Revolution in 2004/05 and Euromaidan in 2013/14.
Unlike the Central European countries, the significant year for Ukraine wasn’t 1989, but 1991 – although in my view, that wasn’t really a watershed year, either. If there was a watershed at all, it occurred in 2013/2014 with Euromaidan and the ‘Revolution of Dignity’. There were two great utopias in mind, the first of which was the grand vision of a national Ukraine as a sovereign state. We wanted to escape from Moscow. Accordingly, the first people we spoke to were the Balts, because they were also striving for independence. The second great utopia was Europe, the West. We had been forcibly separated from Europe in 1945. Having undergone this experience, after 1989/1990 we wanted to return to Europe. Paradoxically, we had no idea what constituted the West. We assumed that the West already knew the way forward and were sure that everything had long been prepared.
Among the intellectuals who drew on Czesław Miłosz, Milan Kundera and György Konrád, the idea of Europe had been developed into the idea of Central Europe since the 1980s. In 1991, Poland, the Czech Republic and Hungary were on their way to formalizing their status as Central Europe with the Visegrád Agreement. For Ukrainian intellectuals, this was a signal to fully enter the Central European discourse and address issues such as plurality, tolerance, solidarity and the past. Our main strategy was to do everything we could to write, argue, speak and think in such a way that we would be regarded as Central Europeans and not be suspected of being post-Soviets. This also led to close cooperation with our Polish colleagues. At the same time, we quickly realized that Central Europe was only a necessary means to enter the true European community, which we desperately wanted to join.
We therefore faced three major tasks. Firstly, we had to do everything we could to be seen as genuine Central Europeans like the Hungarians, Czechs, Slovaks and Poles. Secondly, we had to clearly convey Central Europe as an argument to Russia, which at that time under Yeltsin was still a different entity from what it is today. I think we missed this opportunity. Thirdly, we’d failed to take into account that our ideas of a nation state essentially dated back to the nineteenth century, and that in the meantime Europe and the West were on a completely different path. We wanted to make our mark, be present, no longer be mistaken for anybody else, but didn’t know how to go about this. Conflict was inevitable.
We have to accept that the West isn’t looking forward to us eagerly. On the contrary, old political and cultural borders are currently being cemented anew. Moreover, our outside view of the Europe of the European Community has changed, too: the West is no longer idealized. Note that this is simply de-idealization, not devaluation.
For the countries east of the EU, the same agenda still applies today to the unfinished tasks dating back to the dawn of a new era in 1989/90. The big questions still remain: national sovereignty, European integration and anti-oligarchism – it’s that simple. This utopia of Europe isn’t over, not least because we have no better normative ideal, save in another dimension.
A utopia is thus emerging that deserves to be called such because it is forward-looking and global: the utopia of saving the climate. It could become a new, shared, grand utopia that will unite Europe in the future, and that requires action and activism.
Central Europe must be declared a historical concept, but this isn’t to say that it has lost any of its productivity. It would be careless to put Central Europe aside. Instead, the concept of Central Europe should be resemantized and understood in a way that is geographically detached. Then we can think of Central Europe differently. New Central Europeans live in the midst of European concerns to which they are by no means indifferent and in fact are passionately committed. Today, it could be Central Europeans who stand up against radicalization and division, who mediate between the extremes and seek the new middle. What we need is a Europe able to manage polarization and serious threats: Central Europe as a Europe of the rediscovered spiritual centre.
Durs Grünbein: In einem Europa der Kooperation liegt die Zukunft
"[...] Vielleicht, denke ich manchmal, ist ja ausgerechnet dieses kleine Ostdeutschland, in dem ich meine Kindheit und Jugend verbracht habe, das wahre Herz Europas gewesen. Jedenfalls hat die Gefangenschaft im Realsozialismus stalinistischer Prägung in dem Träumer, der ich damals war und heute noch bin, zu einem proeuropäischen Bewusstsein geführt. [...]" PDF
Der Beitrag ist ein Auszug eines Vortrages, den Durs Grünbein im nordirischen Belfast hielt. Veröffentlicht wurde der Vortrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 18. September 2019
Das Resultat langer Spaltung von Völkern und ihrer Territorien ist ihre Verinnerlichung über Generationen. Der Mensch im geteilten Land ist ein Spaltprodukt. Die verschiedenen Lebenserfahrungen stecken den Menschen einer geteilten Nation noch lange nachher tief in den Knochen. Die divergenten Anschauungen trennen sie, wie sich zeigt, auch noch weit über das Schisma hinaus. Dreißig Jahre nach der deutschen Einheit ist noch immer von „Ostlern“ und „Westlern“ die Rede, wobei der „Ostler“ gewisse Züge eines kolonialistischen Konstrukts trägt. Einerseits ist er der fremde Andere, eine Projektion der Sieger der Geschichte, andererseits hat er sich in seiner Rolle als der Verlierer nun eingerichtet und beharrt trotzig und voller Selbstmitleid auf seinem Anderssein. Nachdem die Konflikte, die zur Spaltung des Landes geführt haben, beendet sind (unter anderem weil beide Seiten in einem kurzen Augenblick der Geschichte euphorisch aufeinander zugingen), wirkt das Trauma der Spaltung doch lange noch nach. Es kann sich auswachsen und das gesellschaftliche Klima vergiften, je länger die politische Integration ausbleibt.
Mir selbst, geboren 1962 im Circus Marxismus, ein Jahr nach Errichtung der Berliner Mauer, ist die Teilung im Rückblick zur größten Lektion geworden. Sie hat mich das doppelte Sehen gelehrt, den dialektischen Blick auf die Verhältnisse geschult. Sie hat aber auch die Sehnsucht nach etwas Größerem geweckt, nach einem höheren Prinzip territorialer Organisation - nennen wir es Europa - gerade weil Deutschland in seiner Zerrissenheit, seinem historischen Scheitern mir als verbranntes Gelände erschien. Ich hatte nicht um die deutsche Einheit gebeten, als ich 1989 in Ost-Berlin mit vielen Tausenden auf die Straße ging mit der Forderung nach Freiheit und Selbstbestimmung, aber als sie dann kam, habe ich sie begrüßt. Dass die DDR und später das ganze sowjetische Imperium so schnell fallen würden, hat mich wie jeden anderen überrascht, das Staunen darüber hält im Grunde bis heute an. Aber das ist noch nicht das Ende dieser Geschichte. Der Traum, in der Nischengesellschaft des Mauer-Deutschlands ausgebrütet, war ein weit größerer.
Vielleicht, denke ich manchmal, ist ja ausgerechnet dieses kleine Ostdeutschland, in dem ich meine Kindheit und Jugend verbracht habe, das wahre Herz Europas gewesen. Jedenfalls hat die Gefangenschaft im Realsozialismus stalinistischer Prägung in dem Träumer, der ich damals war und heute noch bin, zu einem proeuropäischen Bewusstsein geführt. In einem Europa der Kooperation, einem Europa nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch politischer Verflechtung liegt die Zukunft. Jeder Separatismus führt wieder nur in die Niederungen des Nationalismus, in ein Gelände der Grenzen und Zollschranken, das die Gefahr bewaffneter Konflikte in Zukunft wahrscheinlicher macht.
This article is part of a talk given by the author Durs Grünbein in Belfast, Northern Ireland, and which was published in Frankfurter Allgemeine Zeitung on 18 September 2019.
When a nation and its territory are divided for a prolonged period, the experience is internalized for generations. The inhabitants of a divided country are products of this division – and their different life experiences remain deeply ingrained in their bones long after their country has been reunited. Indeed, they remain divided by their divergent views for decades after the schism is over. Thirty years after German unification, people still talk in terms of easterners and westerners, with easterners bearing certain features of a colonialist construct. On the one hand, easterners represent the alien other, a projection among the victors of history; on the other hand, they have now settled down in their role as losers and persist defiantly and full of self-pity in their otherness. Although the conflicts that led to the division of Germany are now over (partly because both sides came together euphorically in a brief moment in history), the trauma of division continues to resonate. And as long as political integration fails to materialize, this trauma can mutate and poison the social climate.
For me, born in Circus Marxism in 1962 – a year after the erection of the Berlin Wall – the division of Germany proved in retrospect to be my greatest lesson. It taught me to view things in two ways, trained me to look at them dialectically. But it also kindled in me a longing for something greater, for a higher principle of territorial organization – let’s call it Europe – precisely because Germany with its inner turmoil, its historical failure, appeared to me like burnt terrain. When I joined many thousands of people on the streets of East Berlin in 1989 to demand freedom and self-determination, I wasn’t calling for German reunification – yet when it happened, I welcomed it. The fact that East Germany and later the whole Soviet empire fell so quickly surprised me as much as anyone else, and this amazement hasn’t really dissipated to this day. But that isn’t yet the end of the story. The dream hatched in the niche society of divided Germany was far bigger.
I sometimes think to myself that perhaps East Germany of all places, this small country where I grew up, was the true heart of Europe. At any rate, my captivity in Stalinist socialism nurtured a pro-European consciousness in the dreamer I was then and still am today. The future lies in a Europe of cooperation, a Europe which is interwoven not just economically but also politically. Any separatism can only lead back to the lowlands of nationalism, to a landscape of borders and customs barriers, which would make the risk of armed conflict in the future more likely.
Ingo Schulze: Provinz in Europa
"Kamen unsere West-Verwandten zu Besuch in die DDR, gebrauchten sie mitunter merkwürdige Redewendungen. Zum Beispiel sagten sie: 'Morgen fahren wir zurück nach Deutschland.' Wer in Charkiw, Kazan, Tirana oder Sarajewo lebt, wird heute genauso unangenehm berührt sein wie ich damals, wenn wir heute von Europa sprechen und dabei die EU meinen. [...]" PDF
19. Mai 2020
Kamen unsere West-Verwandten zu Besuch in die DDR, gebrauchten sie mitunter merkwürdige Redewendungen. Zum Beispiel sagten sie: „Morgen fahren wir zurück nach Deutschland.“ Wer in Charkiw, Kazan, Tirana oder Sarajewo lebt, wird heute genauso unangenehm berührt sein wie ich damals, wenn wir heute von Europa sprechen und dabei die EU meinen.
„Der Amerikaner, der den Kolumbus als erster entdeckte, machte eine böse Entdeckung“, schreibt Lichtenberg. Europäer außerhalb Europas zu entdecken, war tatsächlich keine gute Entdeckung. Ein verantwortliches Handeln, das dieses verübte Unrecht anerkennt, drückt sich verschieden aus: als Kontrolle der Lieferketten für importierte Produkte, als Kampf gegen die EU-Agrarsubventionen, die in afrikanischen Staaten die Märkte für einheimische Bauern zerstören oder in der Diskussion über die Rückgabe von Museumsbeständen an die Herkunftsländer.
Ich lebte länger in der Kleinstadt Altenburg südlich von Leipzig. Dort gab es vor einigen Jahren eine Ausstellung mit dem Titel „Altenburg – Provinz in Europa“. Der Titel ist der Ausdruck eines europäischen Selbstverständnisses, das allerdings nur dann eine Chance hat, wenn ich in europäischen Angelegenheiten mindestens genauso mitbestimmen wie auf nationaler Ebene. Das Parlament, das wir gewählt haben, ist von diesem Anspruch noch um einiges entfernt. Und: „Seit der EuGH das Verbot marktverzerrender staatlicher Beihilfen an Unternehmen auch auf öffentliche Einrichtungen der Daseinsvorsorge erstreckt hat, kann kein Mitgliedstaat mehr selbst bestimmen, was er dem Markt überlassen und was er in Eigenregie übernehmen will.“ (Dieter Grimm) Deshalb gilt es jene Kräfte zu unterstützen, die bereit sind, die EU zu demokratisieren und ihren neoliberalen Wirtschaftskurs zu stoppen.
Für mein jüngstes Buch habe ich eine Figur aus Dževad Karahasans Roman „Der Trost des Nachthimmels“ übernommen. In diesem Zusammenhang habe ich erst begriffen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner Bosniens aufgrund des Dayton-Abkommens gezwungen sind, sich ethnisch zu definieren. Für jene, die nicht zu den drei offiziellen „Ethnien“ gehören, gibt es keine Zugehörigkeit. Diese Konstruktion hat auch zur Folge, dass Beitrittsverhandlungen mit der EU noch nicht mal in Aussicht gestellt werden können. Da sich die Stärke einer Kette bekanntlich nach ihrem schwächsten Glied bemisst, läge für mich der Mittelpunkt Europas in Bosnien.
Whenever our western relatives came to visit us in East Germany, they sometimes used curious expressions. For example, they would say: “Tomorrow we’re going back to Germany!” The unpleasant feeling this gave me is shared by the inhabitants of Kharkov, Kazan, Tirana and Sarajevo today when we talk about Europe, but really only mean the European Union.
“The American who first discovered Columbus made a bad discovery,” wrote Georg Christoph Lichtenberg. Discovering Europeans outside Europe was indeed not a good discovery. Responsible action which acknowledges this injustice is expressed in various ways, such as monitoring supply chains for imported products, campaigning against EU agricultural subsidies which ruin markets for indigenous farmers in African countries, and the debate about repatriating museum artefacts.
For many years I lived in the small town of Altenburg south of Leipzig. A few years ago, an exhibition was held there entitled ‘Altenburg – Province in Europe’. The title reflects one of the ways in which Europe sees itself, although this view only stands a chance if people have at least as much say in European affairs as they do at a national level. The parliament we have elected is still a long way off from this goal. Moreover, “Since the European Court of Justice applied the ban on market-distorting state subsidies for corporations to public service institutions as well, Member States can no longer freely decide which areas to leave to the market and which to govern themselves.” (Dieter Grimm) Accordingly, the forces which are prepared to democratize the EU and put a stop to its neo-liberal economic policy need our support.
For my latest book, I borrowed a character from Dževad Karahasan’s novel The Solace of the Night Sky. This is when I first realized that the inhabitants of Bosnia are forced by the Dayton Agreement to define themselves ethnically. Those who aren’t part of one of the three approved ‘ethnicities’ don’t belong. But this state of affairs means there’s no prospect of accession negotiations with the EU. Since a chain is of course only as strong as its weakest link, in my view, the centre of Europe is in Bosnia.
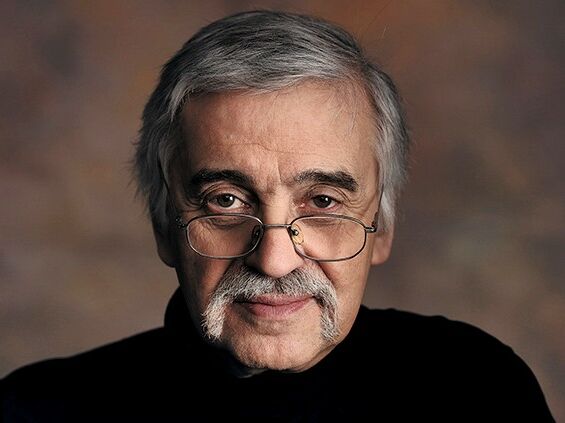
Romuald Loegler: Europa ist keine Idee
"Europa ist keine Idee, sondern es sind die in Vielfalt vereinten Länder des europäischen Kontinents. Europa ist die Quintessenz der europäischen Zivilisation, die in den Begriffen von URBS und CIVITAS enthalten sind. Es ist ein Kontinent der gegenseitigen Durchdringung von Wirtschaft und Kultur, Offenheit, Multiethnizität und kulturellem Pluralismus. Europa ist ein kulturelles Erbe, das unseren Alltag beeinflusst, uns in Städten umgibt und in Naturlandschaften wahrgenommen wird. Kulturerbe ist: Literatur, Kunst, Architektur, Denkmäler, Handwerk ..., ein Gut der Zivilisation, sowohl vom Menschen geschaffene Werke, sowie diejenigen, denen der Mensch selbst Bedeutung gegeben hat. ..." PDF
Bohdan Tscherkes: Europa liegt dort, wo es immer lag
"Das Thema der europäischen Integration hat sehr viele Facetten: sie können wirtschaftlicher, politischer oder ideologischer Natur sein, und je nach Priorität dominiert die eine oder andere Facette; manchmal humanistische Ideale, dann wieder technische Illusionen, [...] Die Rolle der Kunst und der Kunstschaffenden besteht darin, mit künstlerischen Mitteln diese unterschiedlichen Strömungen und Tendenzen bei der europäischen Integration herauszuarbeiten. [...]" PDF
18. Mai 2020
Was bedeutet in Zukunft „europäische Integration“? Welche Rolle können Kunst und Kultur, Künstlerinnen und Künstler bei der Diskussion dieser Entwicklungen spielen?
Das Thema der europäischen Integration hat sehr viele Facetten: sie können wirtschaftlicher, politischer oder ideologischer Natur sein, und je nach Priorität dominiert die eine oder andere Facette; manchmal humanistische Ideale, dann wieder technische Illusionen, wie zum Beispiel heutzutage dieser online-Fanatismus. Die Prioritäten sind im Fluss und ändern sich ständig. Die Rolle der Kunst und der Kunstschaffenden besteht darin, mit künstlerischen Mitteln diese unterschiedlichen Strömungen und Tendenzen bei der europäischen Integration herauszuarbeiten und proeuropäische Ideale zu verbreiten. Oder anders gesagt: die Menschen mit künstlerischen Mitteln vor Pseudorettern und gefährlichen Ansichten zu warnen, weil es immer Menschen geben wird, die gegen die europäische Integration kämpfen werden.
Wo liegt Europa? In Paris? In Brüssel? In den Mittelmeerstaaten? Bei den Višegrad-Staaten?
Europa liegt dort, wo es immer lag, zwischen der Iberischer Halbinsel und dem Ural Gebirge. Es hat sich geographisch und auch kulturell nichts geändert. Es ändern sich nur mentale Konstruktionen und die Zentren der Macht, aber Europa bleibt Europa.
Was bedeutet die Erfahrung der letzten Wochen für unser Verständnis von Europa?
Die Erfahrung der letzten Wochen hat gezeigt, wie klein und verletzlich die Menschheit insgesamt ist. Und die Rolle der Kunst ist rasant gewachsen. In besonders schweren Stunden lese ich Boccaccio aus dem 14 Jahrhundert und denke an die Kirche Santa Maria della Salute von Baldassare Longhena aus dem 17. Jahrhundert am Canale Grande in Venedig als Symbol des Sieges über die Pest. Und was mir von dieser Zeit im Gedächtnis bleiben wird, sind nicht aktuelle Politiker, sondern nur das Leid, die Solidarität von Ärzten, Schwestern, Pflegern und einfachen Menschen, Massen von frierenden heimkehrenden Gastarbeitern an äußeren europäischen Grenzen, nostalgische Musik und die Gebete des einsamen Papstes Franziskus im strömenden Regen am leeren Petersplatz in Rom...
What will ‘European integration’ mean in the future? What part can art, culture and artists play in the discussion of these developments?
The subject of European integration has many different facets. They may be economic, political or ideological, and their relative importance varies in line with shifting priorities, which are in a constant state of flux: sometimes humanistic ideals dominate, at other times technical illusions, such as today’s online fanaticism. The role of art and artists is to use artistic means to highlight these different currents and trends in European integration, and to spread pro-European ideals. Or in other words, to use artistic means to warn people about pseudo-orators and dangerous views – for there will always be those who resist European integration.
Where is Europe? In Paris? In Brussels? In the Mediterranean countries? In the Visegrád Group?
Europe is in the same place it’s always been: between the Iberian Peninsula and the Ural Mountains. It hasn’t changed geographically or culturally. Mental constructions and centres of power may change, but Europe remains Europe.
What does the experience of recent weeks mean for our understanding of Europe?
The past few weeks have shown us how small and vulnerable humanity is as a whole. And the role of art has grown rapidly. When times are especially difficult, I read Giovanni Boccaccio from the fourteenth century; I think of the seventeenth-century Church of Santa Maria della Salute designed by Baldassare Longhena on the Grand Canal in Venice as a symbol of victory over the plague. And what I will remember about this time is not today’s politicians, but just the suffering, the solidarity of doctors, nurses, carers and ordinary people, the crowds of freezing immigrant workers on Europe’s external borders returning home, nostalgic music, and the prayers spoken by the solitary Pope Francis in the pouring rain on the deserted St Peter’s Square in Rome ...

Stephanie Buck / Ulrich Brückner: Was ist Europa?
"Die erste Assoziation bei der Frage nach dem Ort Europas ist der Kontinent, so wie wir es im Geografieunterricht gelernt haben. Gleichzeitig ist Europa aber auch eine Chiffre für die kulturellen Errungenschaften und die Lebensweisen, die hier gepflegt werden und die sich als Distinktionsmerkmale von anderen Teilen der Welt benennen lassen. [...]" PDF
Stephanie Buck, Direktorin des Kupferstich-Kabinetts der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden / Ulrich Brückner, Jean Monnet Professor for European Studies an der Stanford University in Berlin, 12. Mai 2020
Wo liegt Europa? In Paris? In Brüssel? In den Mittelmeerstaaten? Bei den Višegrad-Staaten?
Die erste Assoziation bei der Frage nach dem Ort Europas ist der Kontinent, so wie wir es im Geografieunterricht gelernt haben. Gleichzeitig ist Europa aber auch eine Chiffre für die kulturellen Errungenschaften und die Lebensweisen, die hier gepflegt werden und die sich als Distinktionsmerkmale von anderen Teilen der Welt benennen lassen.
Zivilisatorisch ist es in Europa gelungen, Nationalismen durch überstaatliche Integration und Interdependenz so weit zu zähmen und teilweise zu überwinden, dass unter den Mitgliedern des Integrationsprojekts über den längsten Zeitraum ihrer Geschichte kein Krieg geführt wurde. Gerade als Historikerin mit deutscher Staatsangehörigkeit ist mir dieses Bewusstsein grundlegend, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die davon ausgeht, dass unterschiedlichste Haltungen und Erfahrungen ein schöneres, reicheres Ganzes formen, als es nur eine einzige Herangehensweise zustande bringen kann. Wenn ich „Europa“ denke, spanne ich die Flügel aus und denke nicht Paris, Brüssel, Mittelmeerstaaten oder Višegrad-Staaten. Ebenso wenig denke ich zuerst an Details eines geliebten Kunstwerks, sondern an das Kunstwerk als Ganzes bevor alle Details ihre animierende Kraft entfalten.
Was ist Europa?
Die wirtschaftliche Verflechtung hat eine Schicksalsgemeinschaft geschaffen, bei der der Wohlstand des einen vom Wohlergehen des anderen abhängt. Und die gegenseitige Durchdringung schafft aufgrund der Mobilität von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital nicht nur einen Kultur- und Wirtschaftsraum. Sie beschleunigt auch Gefährdungen, wie sich in der jüngeren Vergangenheit in den Banken-, Schulden-, Populismus- oder Corona-Krisen so eindrücklich zeigt.
Europa als politisches Projekt der Europäischen Union schafft individuelle Freiheit und Lebenschancen, die aber nicht gleichmäßig verteilt sind. Gleichzeitig beschränkt dieses Projekt die Autonomie der Staaten, was zu Widerständen und Konflikten führt.
Europa ist auch eine Rechtsgemeinschaft, die darauf basiert, dass Rechtstaatlichkeit anerkannt und geschützt wird. Vor diesem Hintergrund wirkt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank wie die „Zündung einer Atombombe“ (Prof. Franz Mayer, Bielefeld), weil sie das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit in Frage stellt.
In all diesen Bedeutungen ist Europa kein Ort, sondern eine Entscheidung von Staaten, Gesellschaften und Bürgern, nach gemeinsamen Regeln politisch, ökonomisch und kulturell zusammen zu leben.
Kulturelle Vielfalt ist nur einer von vielen Werten einer europäischen Wertegemeinschaft. In jeder der Krisen der vergangenen Jahre ging es immer auch um Solidarität und um Enttäuschung, wenn Erwartungen an ihre praktische Umsetzung nicht erfüllt wurden. Das hat weniger damit zu tun, dass es keine Solidarität gegeben hat. Vielmehr liegt es daran, dass sich eine Vielzahl von Folgefragen stellen, die je nach Standpunkt unterschiedlich beantwortet werden (Solidarität für was, von wem, mit welchem Ziel, in welchen Umfang, mit welchen Mitteln, in welchem Zeitrahmen, usw.).
Was bedeutet die Erfahrung der letzten Wochen für unser Verständnis von Europa?
Für mich haben die letzten Wochen vielleicht deutlicher als sonst gezeigt, dass viele praktische Fragen lokal am besten zu lösen sind, da die Kenntnis der Situation vor Ort nötig ist, um adäquat und rasch handeln zu können. Gleichzeitig habe ich beim Schließen der Grenzen neu und stark empfunden, welch enormen Wert das europäische Integrationsprojekt hat und dass immer wieder Wege gesucht werden müssen, um nationale Egoismen zu überwinden.
Dieses europäische Integrationsprojekt steht vermutlich vor seiner größten Herausforderung seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft vor 70 Jahren.
Das europäische Haus ist nach wie vor eine Baustelle und zeigt neben einer Vielzahl beachtlicher Integrationserfolge und Leistungen für die Menschen auch zahlreiche Defizite und Dysfunktionalitäten. Die ökonomische Krise als Folge der Pandemie verlangt eine gewaltige Anstrengung der Einzelstaaten und der Europäischen Union, bei der die damit verbundenen Verteilungskonflikte das Potential haben, dass die europäische Einigung scheitert. Eine Alternative im autonomen Nationalstaat zu suchen, ist aber keine, weil Staaten alleine keine Lösungen bieten für die globalen Probleme des 21. Jahrhunderts.
Was bedeutet in Zukunft „europäische Integration“? Welche Rolle können Kunst und Kultur, Künstlerinnen und Künstler bei der Diskussion dieser Entwicklungen spielen?
Es ist mehr denn je notwendig, zu vermitteln, was Europäische Integration bedeutet, welche Errungenschaften wir Europa verdanken, was geschützt werden muss und wo es notwendig ist, zu reformieren. Das kann nur funktionieren, wenn es in einem integrierten Europa auch ausreichend Menschen gibt, die leidenschaftliche Europäer sind. Diesen Diskurs zu führen, sich einzumischen, konstruktive Kritik an Politik zu üben, das Projekt weiterzuentwickeln und gleichzeitig zu schützen, was zu den Voraussetzungen unserer Freiheitsrechte gehört, das ist Aufgabe aller gesellschaftlichen Gruppen und Individuen, ganz besonders aber der Kunst und Kultur, weil sie andere Mittel und Perspektiven einbringt, als es ein selbstreferentieller, professioneller Politikbetrieb leisten kann. Künstlerisch kreative Antworten erreichen Menschen nicht nur im Kopf, sondern auch auf sinnlichere Weise, „subkutan“ und damit nachhaltiger als rein zerebral. Künstlerische Sprachen können zudem Sprachgrenzen in vielerlei Hinsicht überwinden. Es ist äußerst wichtig, dass das Feld nicht einseitig einer ökonomistischen Rationalität überlassen wird. Der Binnenmarkt und die Währungsunion generieren zwar Wohlstand, aber das kalte Herz neoliberaler Funktionslogik mobilisiert nicht die Unterstützung, ohne die jedes politische Projekt zum Scheitern verurteilt ist. Europa wäre leichte Beute für populistische und nationalistische Vereinfacher. Je kreativer unsere Antworten, desto attraktiver wird Europa als Ort sein, wo ich leben möchte.
Where is Europe? In Paris? In Brussels? In the Mediterranean countries? In the Visegrád Group?
When trying to pinpoint the location of Europe, the first thought that springs to mind is the continent, as we learned at school in geography. Then again, Europe is also a symbol of the cultural achievements and the ways of life cultivated there, and which distinguish it from other parts of the world.
In terms of civilization, Europe has succeeded in subduing and partly overcoming nationalisms by means of supranational integration and interdependence such that war has not been waged among the members of the integration project for the longest period in European history. To me as a historian with German nationality, this awareness of being part of a community which believes that diverse attitudes and experiences create a richer, more beautiful whole than can be achieved by going solo is fundamental. When I think of ‘Europe’, I don’t just think of Paris, Brussels, the Mediterranean countries or the Visegrád Group – I spread my wings. Similarly, when I consider a favourite work of art, I don’t start by thinking about various details. Instead, before the details unfold their stimulating power, I think of it as a whole
What is Europe?
Economic interdependence has created a community with a common destiny in which the prosperity of one depends on the well-being of the other. But this reciprocal interchange doesn’t just create a single cultural and economic area through the mobility of goods, services, people and capital. It also accelerates hazards, something which has been eminently demonstrated in the recent banking, debt, populist and Covid-19 crises.
As a political project of the European Union, Europe creates individual freedoms and life opportunities. However, they aren’t evenly distributed. Furthermore, this project limits individual states’ autonomy, leading to resistance and conflict.
Europe is also a community based on the acceptance and protection of the rule of law. Given this, the decision of the Federal Constitutional Court of 5 May on the monetary policy of the European Central Bank had the effect of “detonating an atom bomb” (to quote Professor Franz Mayer, Bielefeld) because it calls into question the principle of the rule of law.
In all these meanings, Europe is not a place, but a decision taken by states, societies and citizens to live together politically, economically and culturally according to common rules.
Cultural diversity is just one of many values of a European community of values. In each of the crises of recent years, whenever expectations of the practical action it should take weren’t met, solidarity and disappointment have always been part of the equation. This is due not to a lack of solidarity, but to the large number of follow-up questions arising, the answers to which vary depending on your point of view (solidarity for what, by whom, to what end, to what extent, by what means, in what timeframe, etc.).
What does the experience of recent weeks mean for our understanding of Europe?
For me, the last few weeks have shown perhaps more clearly than usual that many practical questions are best solved locally. After all, knowledge of the situation on the ground is necessary in order to take adequate, rapid action. Nevertheless, when the borders were closed, I became acutely aware of the enormous value of the European integration project and the need to keep finding new ways to overcome national egotisms.
This European integration project is probably facing its biggest challenge since the foundation of the European Community seventy years ago.
The European house is still a construction site. Although there have been many remarkable integration successes and achievements for the people, numerous shortcomings and dysfunctions are still evident. The economic crisis triggered by the pandemic requires a huge effort on the part of individual states and the European Union, and the related distribution conflicts have the potential to cause European unification to fail. However, seeking an alternative in autonomous nation states isn’t an option, because states alone can’t provide solutions to the global problems of the twenty-first century.
What will ‘European integration’ mean in future? What role can art and culture as well as artists play in the discussion about these developments?
It’s now more necessary than ever to convey what European integration means, what achievements we owe to Europe, what needs to be protected, and where reform is necessary. This can only work if there are enough people who are passionate Europeans in an integrated Europe. It’s the responsibility of all social groups and individuals, and especially of art and culture, to engage in this discourse, to intervene, to criticise politics constructively, to develop the project further, and at the same time to protect what is one of the prerequisites of our civil liberties, because they apply different means and perspectives from those seen in self-referential, professional policymaking. Artistically creative answers reach people not only in the head, but also via the senses, they get ‘beneath the skin’, and so their effect is longer-lasting. Artistic languages can also overcome language barriers in many ways. It’s vital not to allow an economic rationality to take over. The internal market and monetary union may generate prosperity, but the cold heart of neoliberal functional logic can’t mobilize the support without which any political project is doomed to failure. Europe would then be easy prey for populist and nationalist simplifiers. The more creative our answers, the more attractive Europe will be as the place where I want to live.
Wolfgang Kil: Europa - Zweckgemeinschaft oder Herzensprojekt?
"Die Pandemie hat europäische Zustände unbarmherzig ausgeleuchtet. Krasser noch als während der „Flüchtlingskrise“ wurden im Alarmmodus existenzieller Not Verhaltensweisen sichtbar, Abschottungsreflexe, Rivalitäten, die bislang lieber verdrängt [...] waren. Dabei sind es doch gerade schmerzliche Wahrheiten, die klärender Auseinandersetzung bedürfen. Soweit mein persönliches Erinnern zurückreicht, war mir Europa nie anders als eine hehre Idee erschienen. [...] – EUROPA! Etwas, wovon man träumen konnte. [...]" PDF
26. Mai 2020
Die Pandemie hat europäische Zustände unbarmherzig ausgeleuchtet. Krasser noch als während der „Flüchtlingskrise“ wurden im Alarmmodus existenzieller Not Verhaltensweisen sichtbar, Abschottungsreflexe, Rivalitäten, die bislang lieber verdrängt, ideologisch verbrämt oder von ernsthafter Diskussion gleich ganz ausgeschlossen waren. Dabei sind es doch gerade schmerzliche Wahrheiten, die klärender Auseinandersetzung bedürfen.
Soweit mein persönliches Erinnern zurückreicht, war mir Europa nie anders als eine hehre Idee erschienen. Über alle Misslichkeiten des deutschen Vereinigungsprozesses hinweg habe ich mich, wie so viele, immer wieder getröstet mit der Erwartung einer weiteren, höheren, inspirierenderen Perspektive – EUROPA! Etwas, wovon man träumen konnte. Eine Assoziation von besseren Menschen unter besseren Umständen, um das Schicksal unseres Planeten vielleicht doch noch zum Besseren zu lenken. War das naiv?
Und wann hat das aufgehört, dieses Träumen? Europa, das eigentlich idealistische Projekt, kam in der praktischen Durchführung zunehmend als undurchschaubare Normierungsinstanz und ökonomischer Umverteilungsmechanismus daher. Nicht erst beim Rasen schamloser Ressentiments angesichts der griechischen Finanznöte, schon am Umgang mit den „Neuzugängen“ der Ost- und Südosteuropäer wurde sichtbar, dass an die Stelle verbindender Herzlichkeit zunehmend Nützlichkeitserwartung getreten ist. Der Staatenbund – nichts als ein Zweckverband?
Im Dezember vergangenen Jahres diskutierten Mitglieder unserer Akademie über „Utopie-Entwürfe 1989/1990 in Ost-Europa“, eine hochspannende Veranstaltung, von der mir eine Bemerkung besonders in Erinnerung geblieben ist: Nach Auffassung des ukrainischen Kollegen Jurko Prochasko sei es den Osteuropäern bei ihrem EU-Beitritt weniger um „europäische Ideale“ gegangen, in erster Linie wollten sie „einfach weg von Moskau“. Eine durchaus nachvollziehbare Motivation, die – nur mal ernsthaft in Betracht gezogen – manches Stottern im europäischen Motor erklären würde. Als von den „widerspenstigen“ Visegrád-Staaten Vergleiche zwischen Brüssel und Moskau als schuriegelnde Führungsinstanzen bemüht wurden, hätten bei Verfechtern der europäischen Einigung die Alarmglocken schrillen müssen: Eine von all ihren Bürgern erleb- und gestaltbare Union wird ohne intensive Arbeit an den diversen „Nationalen Fragen“ nicht wirklich zustande kommen. Die schroffe Zurückweisung jeder nationalstaatlichen Ambition, ihre Diffamierung als antiquiert oder gar destruktiv, geht an den Ausgangslagen und heutigen Realzuständen gar nicht weniger Mitgliedsländer schlicht vorbei.
Der Berliner Soziologe Wolfgang Engler hat dazu einige ernüchternde Einsichten notiert: „Die Kritik am ‚Vorpreschen‘ der Nationalstaaten, am neuen Isolationismus angesichts der Pandemie verwechselt Wunsch und Realität […] Überlebenseinheiten im existentiellen Sinn des Wortes bilden auf absehbare Zeit WIR als Franzosen, Italiener, Spanier, Deutsche, WIR als Bayern, Sachsen, Mecklenburger, WIR als Münchner, Leipziger, Berliner etc., und eben weder als Europäer oder Weltbürger, seien es derer auch Hunderttausende. Der heimtückische Erreger evaluiert die Intensität und Verlässlichkeit von Wir-Bindungen, und zwar unparteiisch.“ (Berliner Zeitung am 21. April 2020)
Die kindliche Zuversicht, nach der ausgiebiges Wünschen schon noch helfen wird, sollte nach den einschneidenden Erfahrungen der letzten Wochen ein Ende haben. Subsidiarität, das Handlungsprinzip eines weitgehend dezentralisierten „Europas der Regionen“ darf nicht bloß proklamiert, sondern muss in jeder aufkeimenden Problemlage neu durchdekliniert werden, in aller Offenherzigkeit. Die ideelle Verfasstheit unseres kontinentalen Nachbarschaftsvereins bedarf dringend einer Inventur. Einschließlich Selbstkritik! Um daraus womöglich Grundsätze zu destillieren für ein kulturelles „Vielvölker-Bündnis“, in dem unterschiedliche Herkünfte jeweils gleichen Respekt genießen und nationales Eigensein nicht als Querulantentum gilt.
The pandemic has shone a harsh spotlight on European conditions. Even more starkly than during the ‘refugee crisis’, behaviour patterns have been exposed in the alarm mode of existential distress along with rivalries that were previously repressed, ideologically glossed over, or excluded from serious debate. Yet it is precisely such painful truths that require clarification.
As far back as I can remember, Europe had never seemed to me to be anything but a noble idea. Throughout all the unfortunate aspects of German unification, like so many other people, I always consoled myself with the expectation of a greater, more inspirational future: EUROPE! It was something I could dream about – an association of better people living in better circumstances, perhaps able to change the fate of our planet for the better. Was that naive?
When did this dreaming stop? Europe, originally an idealistic project, increasingly came to be regarded in its practical implementation as an inscrutable normative authority and an economic redistribution mechanism. The creeping replacement of the warmth of the common bond by expectations of utility became apparent not only against the background of shameless resentment over Greece’s financial difficulties, but also beforehand in the treatment of the ‘new arrivals’ from eastern and southeast Europe. Was the confederation of states nothing more than a partnership of interests?
In December last year, members of our Academy discussed ‘Designs of Utopia 1989/1990 in Eastern Europe’. It was a fascinating event, and one observation in particular has stuck in my mind. In the opinion of our Ukrainian colleague Yurko Prokhasko, east Europeans when they joined the EU were less interested in ‘European ideals’ than in ‘escaping from Moscow’. This is a perfectly understandable motive which – if only seriously considered – would explain some sputtering in the European engine. When the ‘recalcitrant’ members of the Visegrád Group began accusing Brussels of emulating Moscow’s bullying, alarm bells should have rung for supporters of European integration. A genuine union that can be experienced and shaped by all its citizens won’t come about devoting a great deal of effort to the various ‘national questions’. Curtly rejecting all national ambitions, defaming them as antiquated or even destructive, simply sweeps the initial and current circumstances of more than just a few Member States under the carpet.
The Berlin sociologist Wolfgang Engler has noted some sobering insights: “Criticism of the ‘rushing ahead’ of nation states, of the new isolationism in the face of the pandemic, confuses desire with reality ... In the foreseeable future, survival units in the existential sense of the term will be WE as French, Italians, Spaniards, Germans, WE as Bavarians, Saxons, Mecklenburgers, WE as residents of Munich, Leipzig, Berlin etc., and not as Europeans or citizens of the world, even if there are hundreds of thousands of such groups. This insidious pathogen evaluates the intensity and reliability of WE-connections, and does so impartially.” (Berliner Zeitung, 21 April 2020)
The childlike confidence (which would be aided by widespread wishing) ought to be ended by the drastic experiences of the last few weeks. Subsidiarity, the principle of action of a largely decentralized ‘Europe of regions’, must not merely be proclaimed, but must be candidly redefined in every difficult situation that emerges. The ideal state of our continental neighbourhood association urgently needs to be inventoried – including self-critically! – so that we can distil principles for a cultural ‘multination alliance’ where different origins enjoy equal respect and national identity is not simply regarded as bellyaching.
Fragen nach dem Selbstverständnis Europas
"Es gibt keine Zweifel daran, dass Adelbert von Chamisso in unserer Epoche seine Suche nach einer universellen Identität des Europäers entschieden fortgesetzt hätte." An dieses Leitmotiv knüpfte der in Polen geborene Autor Artur Becker an, Dozent der 2020 neu initiierten Chamisso-Poetikdozentur. Artur Becker verortet sich in der geistigen Republik der Kosmopolen, ein provozierender Begriff, der seine Energie aus den drängenden Fragen nach dem Selbstverständnis Europas, der Angst vor neu aufbrechenden Nationalismen und der Frage nach der eigenen Identität bezieht. "Lasst uns unsere europäische Identität erfrischen", Gespräch mit Artur Becker und dem Schriftsteller und Theologen Christian Lehnert.
Auszug aus dem Gespräch zur Vorlesung der Chamisso-Poetikdozentur „Die Identität der Kosmopolen und die Rückkehr der Nationalismen“ von Artur Becker vom 24. September 2020. Das Gespräch führte der Schriftsteller und Theologe Christian Lehnert. Den Videomitschnitt der Vorlesung finden Sie hier.
Christian Lehnert: Artur Becker, Sie verorten sich weder in Deutschland noch in Polen, sondern bezeichnen sich gern - mit einem Anflug von Provokation - als Kosmopolen. Das ist ein unglaublich schillerndes Wort, das bis hinein in kosmologische, eschatologische, utopische Dimensionen reicht. Was ist ein Kosmopole?
Artur Becker: Diese Frage liebe ich. Ein Kosmopole wohnt in der Republik Kosmopolen. Er möchte nicht im Land Ulro, in der Hölle auf Erden leben, wie sie von Faschisten, Kommunisten oder von konsumfanatischen Politikern geschaffen worden ist. Ein Kosmopole lebt ontologisch und existentiell sehr bewusst. Er fragt sich, was ist beständig?
Warum müssen heute in erster Linie Muttersprache, nationales Bewusstsein und die Kulturgeschichte des Heimatlandes bestimmend sein? Das galt im 19. Jahrhundert als Fortschritt, doch dieser moderne und schnelle Prozess ist meiner Meinung nach kläglich gescheitert. Für die Nationalismen im 20. Jahrhundert haben wir einen viel zu hohen Preis bezahlt und wir haben gesehen, dass diese zu nichts führen. Das wäre die irdische Beantwortung der Frage. Wenn wir sie weiterdenken, treibt den Kosmopolen die Frage um, in welcher geistigen Republik wir leben. Die Menschen in Europa, insbesondere unsere Regierungen, Intellektuellen, Künstler und Politiker, also diejenigen, die geistig Europa gestalten, müssen sich fragen, in welcher geistigen Republik sie leben. Was ist das für ein Raum? Lebe ich in einem Raum, indem das Absurde regiert?
Mit war sofort klar, dass ich eigentlich weder in Deutschland noch in Polen leben kann, doch wenn ich heute sagen würde, ich sei ein Kosmopolit, dann stimmt das nicht mehr, denn dieses Wort hat seine Stärke verloren. Ich habe meine eigene geistige Republik und ich lade gerne Gäste ein. Ich möchte sagen: Lasst uns unsere europäische Identität erfrischen, weil sie sehr verstaubt ist. Wenn die Regierenden sagen, wie wichtig Europa sei, bin ich mir nicht sicher, ob sie wirklich verstehen, was Europa, ein kompliziertes Gebäude, eigentlich ist.
Christian Lehnert: Eine für das Selbstverständnis Europas, für unsere heutigen Diskussionen innerhalb unserer Gesellschaft über neue aufbrechende Nationalismen wichtige Frage: Muss der Kosmopole seine nationale Identität aufgeben?
Artur Becker: Nein. Es gibt auch einen gesunden Patriotismus. Patriotismus und Konservatismus haben nichts mit rechtsnationalem Nationalkonservatismus zu tun. Das ist das Angebot. Man muss nicht unter Defätismus leiden. Man kann sein Land behalten, man muss seine Wurzeln nicht ablegen, wie es unter den Emigranten, speziell den Russen und Türken in Deutschland verbreitet ist, die ihre Kultur und Bräuche bewahren. Aber man muss open-minded sein, man muss offen sein, für das Land, in dem man lebt. Wenn man das nicht tut, dann wird man in diesem Land nicht glücklich. Das ist an dem Kosmopolen soweit verständlich. Doch die wichtigste Frage bleibt, was das Beständige an uns ist. Wenn unsere nationalen Identitäten so zerbrechlich sind, so bedeutet das für einen Schriftsteller, fragen zu müssen, was für eine Identität der Mensch hat. Das ist die Frage, die Iwan Karamasow in den Wahnsinn getrieben hat. Wenn Literatur das nicht leistet, wenn sie diese Frage nicht stellt. dann hat sie für mich verloren.
In 2020, the polish writer Artur Becker was awarded the Chamisso-Poetics Readership. His first lecture entitled ‘The Identity of Cosmopoles and the Return of Nationalisms’ was delivered on 24 September and can be viewed here. The following is an extract from the interview conducted to mark this occasion.
Christian Lehnert: Artur Becker, you’re based in neither Germany nor Poland; instead, you like to call yourself – with a hint of provocation – a ‘cosmopole’. This is a term which is difficult to pin down, and which has cosmological, eschatological, utopian dimensions. What exactly is a cosmopole?
Artur Becker: I love this question! A cosmopole is an inhabitant of the Republic of Cosmopole. Cosmopoles don’t want to live in the land of Ulro, the hell on Earth created by fascists, communists or consumption-obsessed politicians. In ontological and existential terms, Cosmopoles live very consciously. They ask themselves what their enduring qualities are. Why should above all mother tongue, national consciousness and the cultural history of a person’s home country be decisive? Although this was considered progress in the nineteenth century, in my opinion this modern, rapid process has failed miserably. We paid far too dearly for the nationalisms of the twentieth century, and we saw that they led nowhere. That’s the worldly answer to the question. To expand on this, the cosmopole is preoccupied by the question of what spiritual republic we inhabit. The people of Europe, especially our governments, intellectuals, artists and politicians – in other words, those who shape Europe spiritually – must ask themselves what spiritual republic they live in. What kind of space is it? Do I live in a space where the absurd reigns?
It was immediately obvious to me that I can’t really live in Germany or Poland. But if I were to call myself a cosmopolitan, that wouldn’t be true either, for the word has lost its strength. I have my own spiritual republic and I like to welcome visitors there. It’s time to refresh our European identity, which has become rather outdated. When those in power say how important Europe is, I’m not sure they really understand what the complicated structure known as Europe really is.
Christian Lehnert: Allow me to ask a question which is important with respect to how Europe views itself and our current debate in society about re-emerging nationalisms. Must cosmopoles abandon their national identity?
Artur Becker: No. There’s also a healthy form of patriotism. Patriotism and conservatism have nothing to do with right-wing national conservatism. You don’t have to suffer from defeatism. You don’t have to shed your roots, you can keep your country – something we often see among emigrants, especially Russians and Turks living in Germany, who preserve their culture and customs. But you have to be open-minded, you have to be receptive to the country you live in. If you aren’t, you won’t be happy there. The cosmopole understands this. But the most important question that remains is: What are our enduring qualities? If our national identities are so fragile, writers need to ask what sort of identity people have. This is the question that drove Ivan Karamazov insane. If literature doesn’t do this, if it doesn’t pose this question, in my view it has lost.
Europa zwischen Globalisierung und Renationalisierung
Solidarität mit den Studierenden und Lehrenden der Theater- und Filmuniversität Budapest (SZFE)
Die Freiheit der Kunst gegenüber Staat und Gesellschaft zu vertreten ist eine der Aufgaben der Sächsischen Akademie der Künste (§1, 1-2 Satzung). Mit größter Besorgnis sieht die Sächsische Akademie der Künste die Maßnahmen der ungarischen Politik, die die freie Entwicklung künstlerischer Ausbildung beeinträchtigen und erklärt sich solidarisch mit den Studierenden und Lehrenden, die seit Anfang September 2020 gegen die Untergrabung der Unabhängigkeit der Universität für Theater- und Filmkunst Budapest (SZFE) protestieren.
Solidarität mit den Studierenden und Lehrenden der Theater- und Filmuniversität Budapest (SZFE).
Seit Anfang September protestieren Studierende und Lehrende der Theater- und Filmuniversität Budapest (SZFE) in Budapest gegen die Verletzung der Autonomie ihrer Hochschule. Die Übernahme der Universität durch die regierungsnahe „Stiftung für Theater und Filmkunst“ hat bereits zum Rücktritt der Universitätsleitung und vieler renommierter Lehrkräfte geführt.
Am 23. Oktober 2020, dem Jahrestag der ungarischen Revolution 1956, demonstrierten rund 10.000 Menschen mit der Botschaft „Die Kunst ist frei“ gegen die neue Hochschulleitung und ihr Vorgehen. Erklärtermaßen will der Stiftungsvorsitzende Attila Vidnyánszky, Intendant des Budapester Nationaltheaters, der 115 Jahre alten Theater- und Filmhochschule ihren „Elitismus“ austreiben und die Lehre künftig auf „die Nation, die Heimat und das Christentum“ konzentrieren. Der zum Kanzler der Hochschule beförderte ehemalige Stabschef im Verteidigungsministerium, Oberst Gábor Szarka, hat in zwei Gebäuden des Campus das Internet abschalten und die Datenkabel kappen lassen. In einem Fernsehinterview rühmte er sich seines persönlichen Durchgreifens. Er werde „so weit gehen wie möglich“, um „diese Art von innerer Anarchie“ zu beenden.
Die Sächsische Akademie der Künste ist höchst besorgt über die Ausschaltung der demokratisch gewählten Organe der SZFE und betont die unverhandelbare Freiheit in Kunst, Wissenschaft und Lehre, die ein Grundpfeiler europäischen Selbstverständnisses ist. Ein an Nationalismus orientierter Kunst- und Bildungsbegriff hingegen gehört endgültig auf den Schrottplatz der unheilvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts.
Wir solidarisieren uns mit den Studierenden, den zurückgetretenen Lehrenden, dem zurückgetretenen Rektorat und dem zurückgetretenen Senat der Budapester Universität für Theater und Filmkunst SZFE und fordern die uneingeschränkte Wiederherstellung der Autonomie der Universität.
Wir erwarten von den Regierungen aller EU-Staaten, dass sie auf die ungarische Regierung einwirken, den Leitungsgremien alle ihre Kompetenzen zurückzugeben.
Die Sächsische Akademie der Künste erklärt sich solidarisch mit allen Künstlerinnen und Künstlern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich für die Freiheit von Kunst und Bildung einsetzen.
Der Senat der Sächsischen Akademie der Künste, 26. November 2020
Declaration of solidarity with the students and lecturers of the SZFE University of Theatre and Film Arts in Budapest
Since the beginning of September, students and faculty of the SZFE University of Theatre and Film Arts in Budapest, Hungary, have been protesting against the violation of their autonomy. The takeover of the university by the government-affiliated Foundation for Theatre and Film Arts has already prompted the university management and many distinguished members of the teaching staff to resign.
On 23 October 2020, the anniversary of the 1956 Hungarian Revolution, around 10,000 people demonstrated under the slogan “Art is free” against the foundation’s new board of trustees now running SZFE. The Foundation’s chair Attila Vidnyánszky, who is also the director of Budapest National Theatre, has stated his intention to drive out “elitism” at SZFE, an institution which is 115 years old, and focus teaching in future on “the nation, the homeland and Christianity”.
Colonel Gábor Szarka, a former chief of staff at the Ministry of Defence who has now been appointed chancellor of SZFE, has switched off the internet in two buildings on its campus and cut the data cables. In a television interview, he boasted about his personal crackdown and said he would do whatever it took to end “this manner of internal anarchy”.
The Saxon Academy of Arts is highly alarmed at the abolition of the democratically elected organs of SZFE. It emphasizes that freedom in art, research and higher education is non-negotiable and is a cornerstone of Europe’s conceptual self-image. By contrast, a concept of art and education geared towards nationalism definitely belongs on the scrap heap of the disastrous history of the twentieth century.
We hereby declare our solidarity with the students of the SZFE Budapest University of Theatre and Film Arts, the members of faculty who have resigned, as well as the rectorate and the senate, who have also stepped down, and call for the full restoration of the university’s autonomy.
We expect the governments of all EU Member States to put pressure on the Hungarian government to return to the governing bodies of SZFE their full powers.
The Saxon Academy of Arts declares its solidarity with all artists and scholars who champion the freedom of the arts and education.
Senate of the Saxon Academy of Arts, 26 November 2020